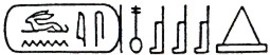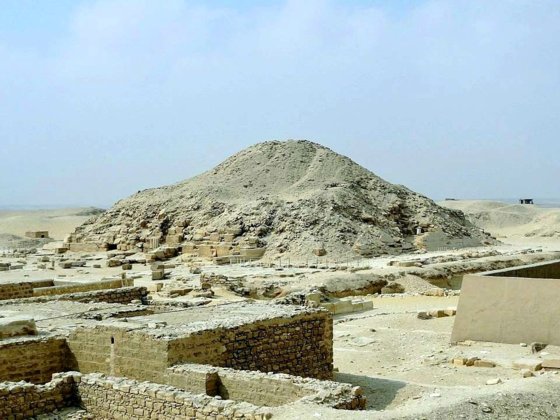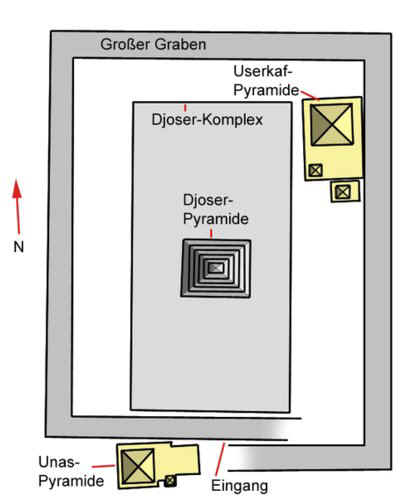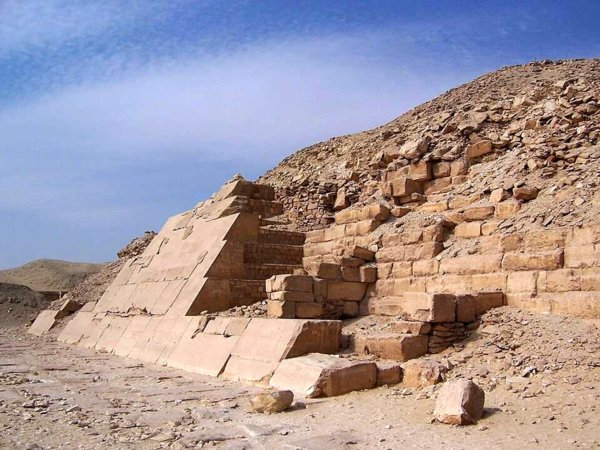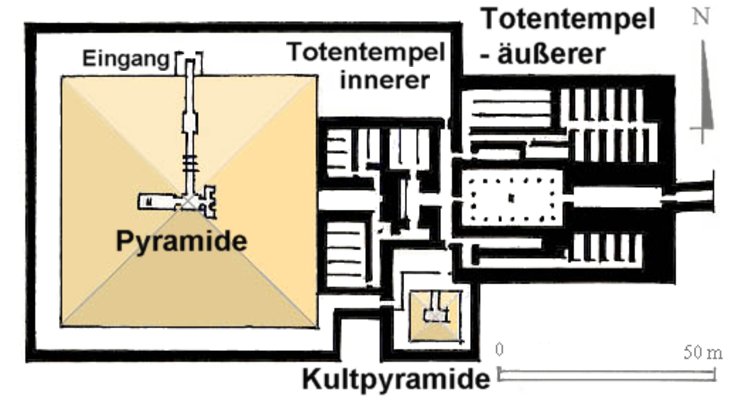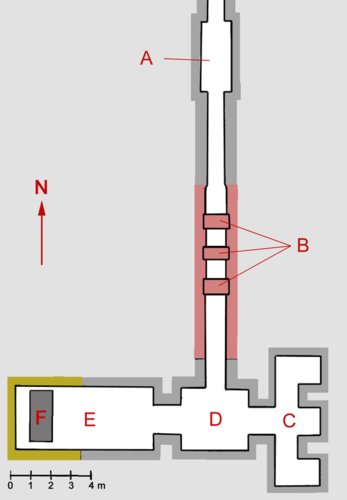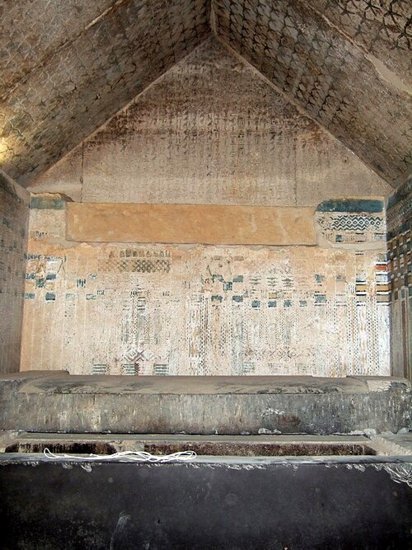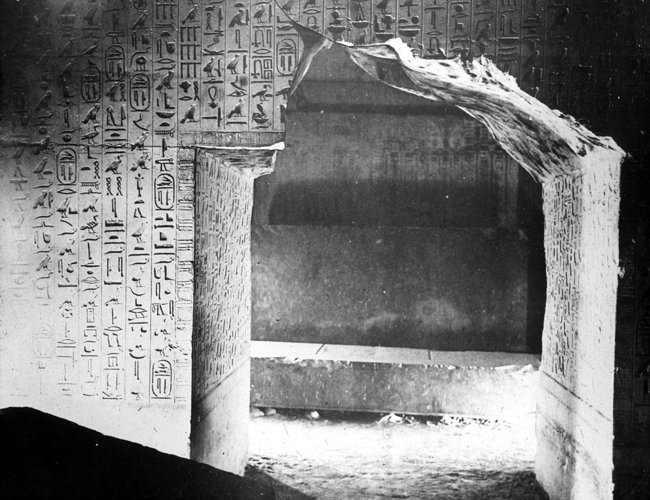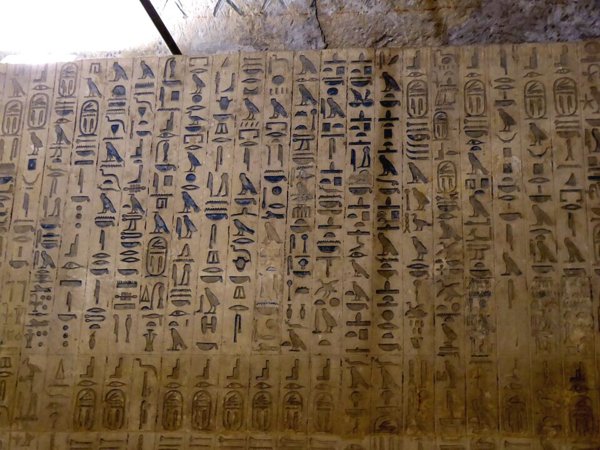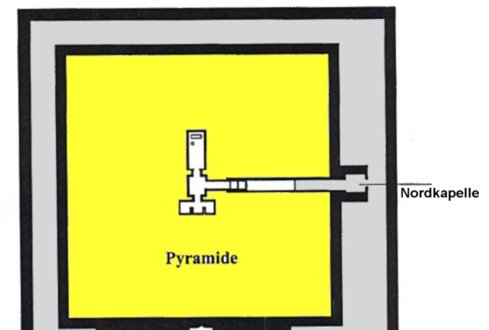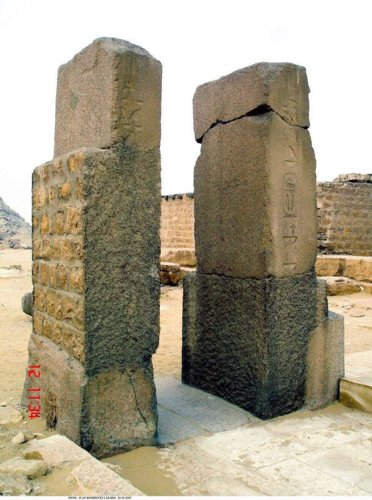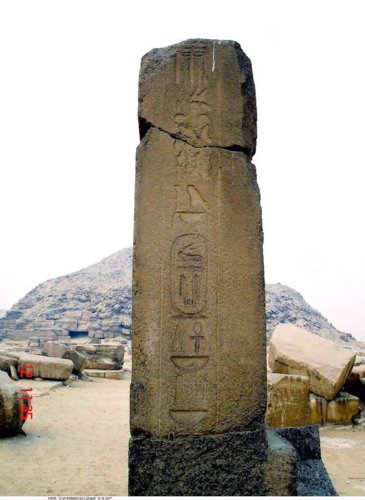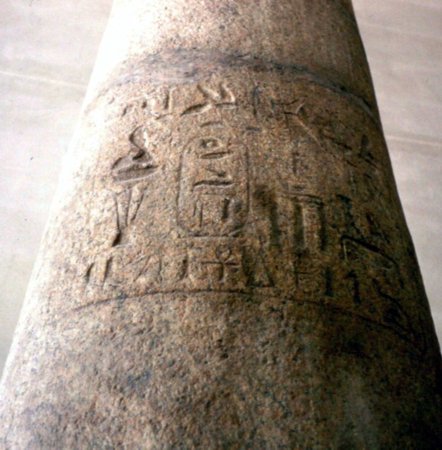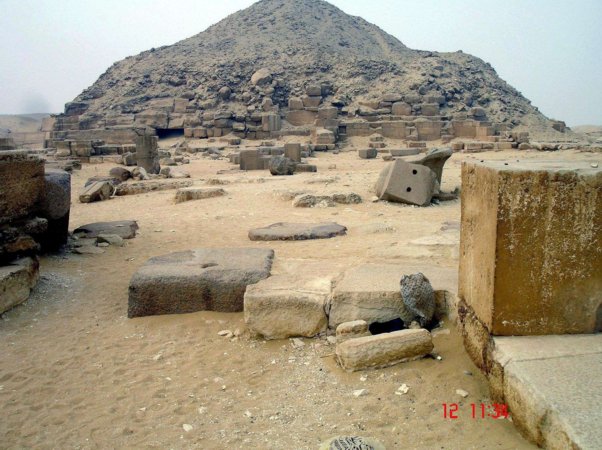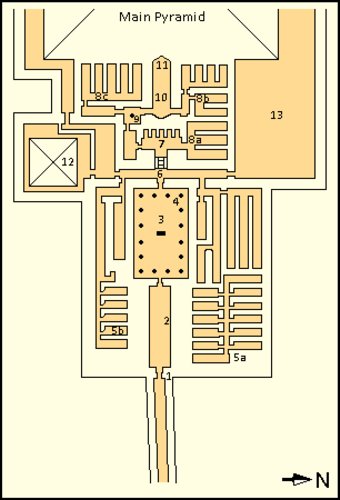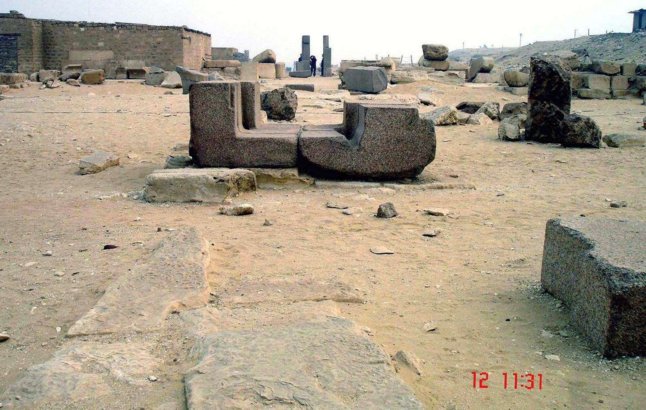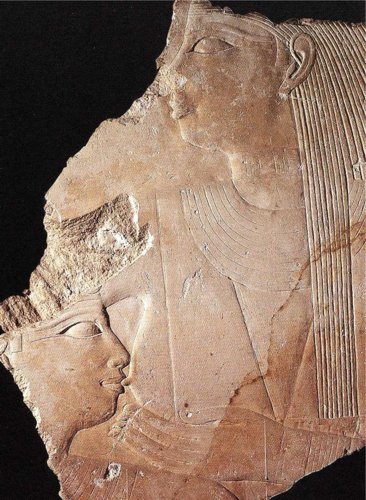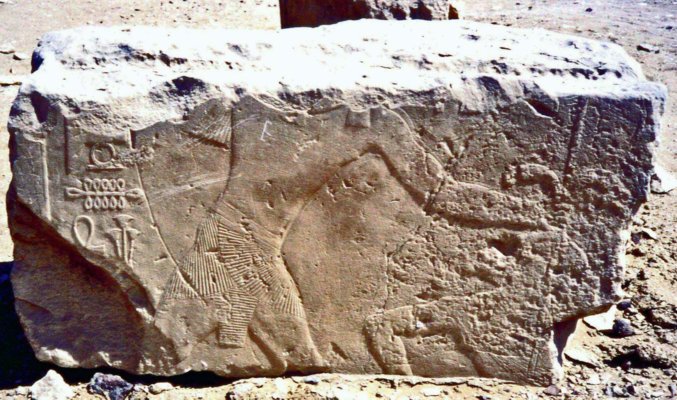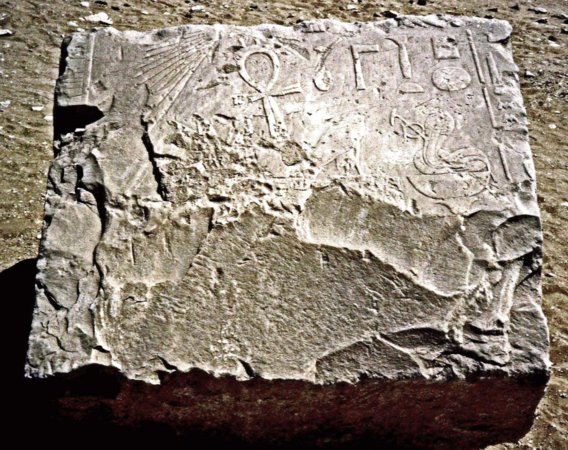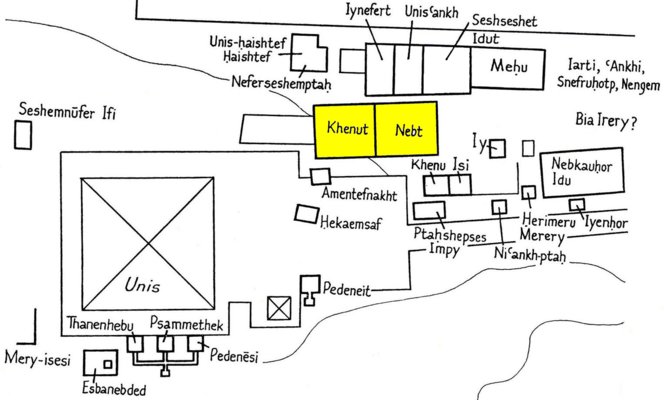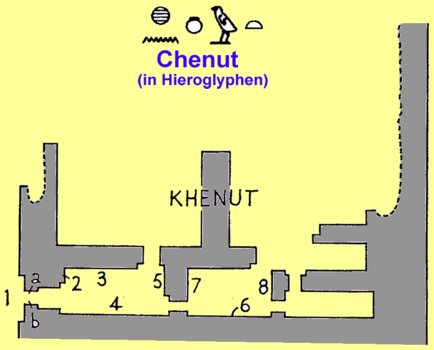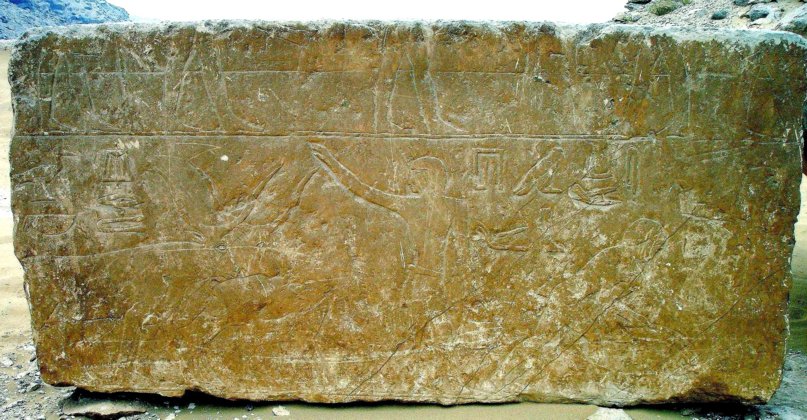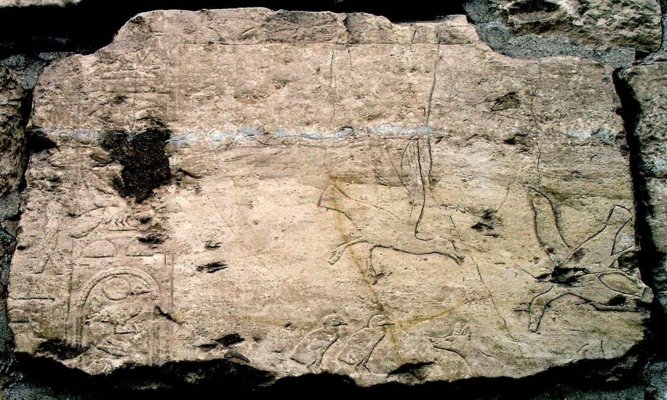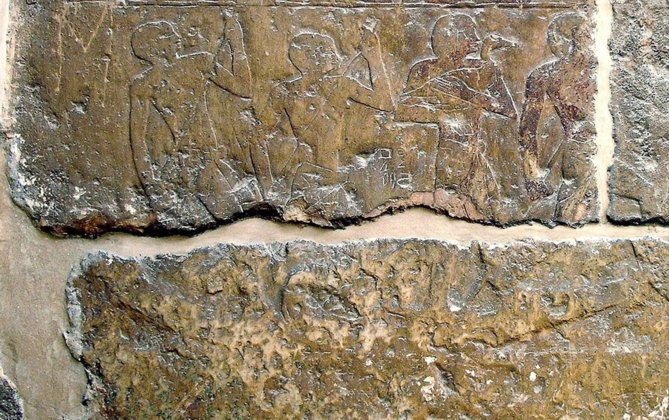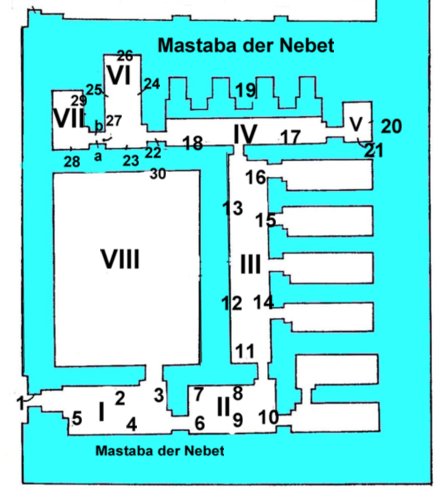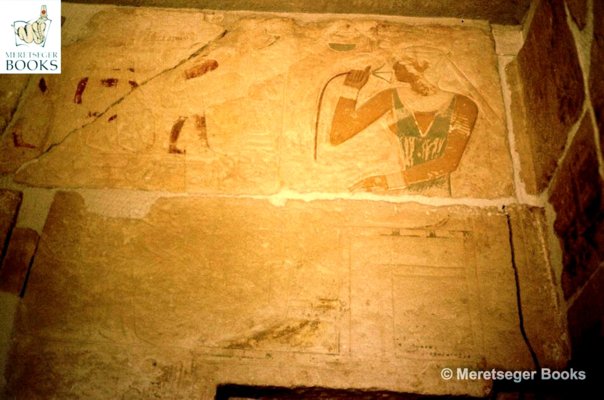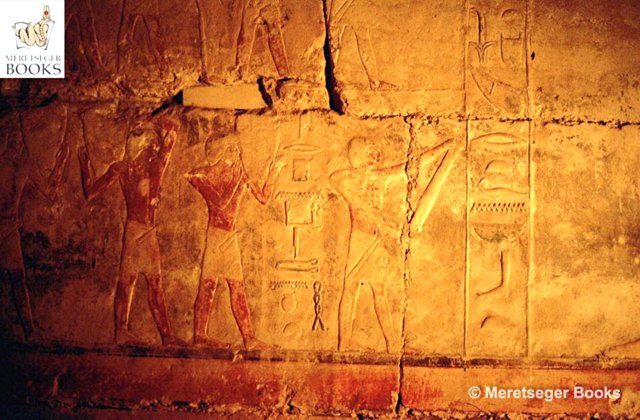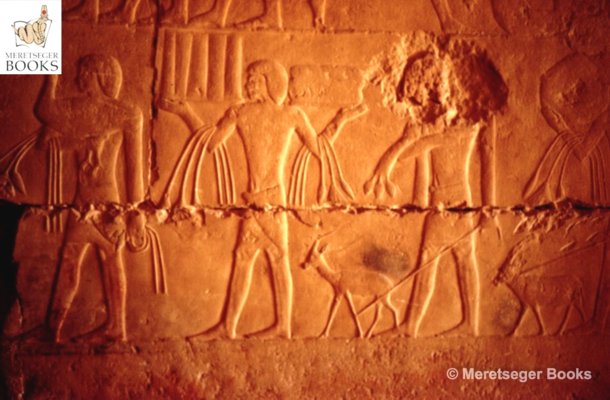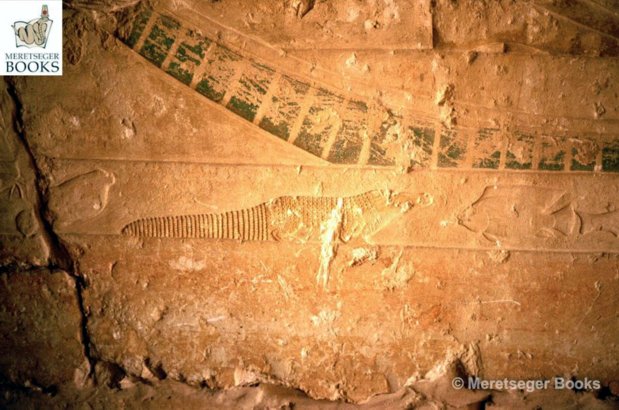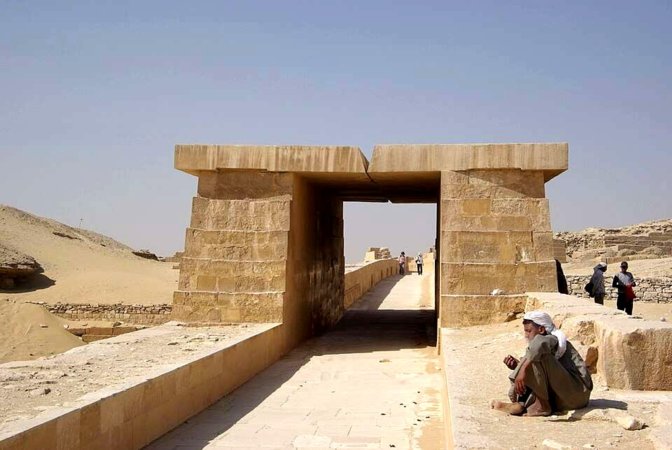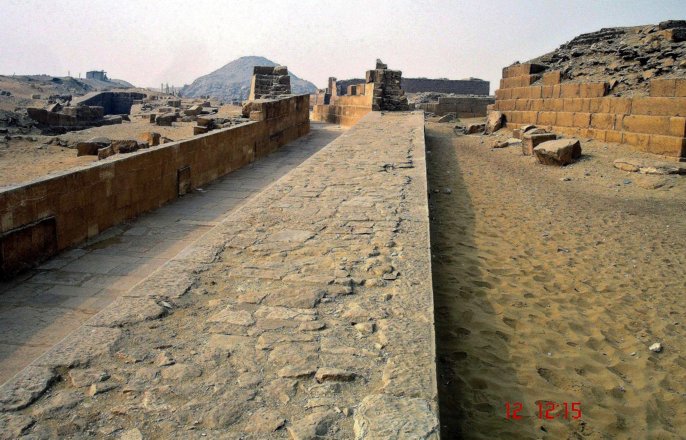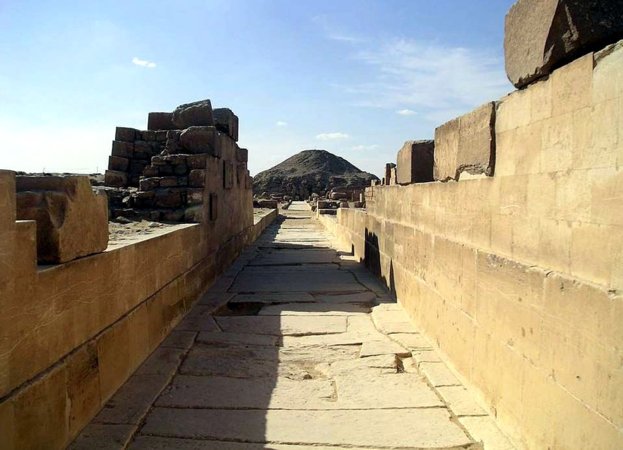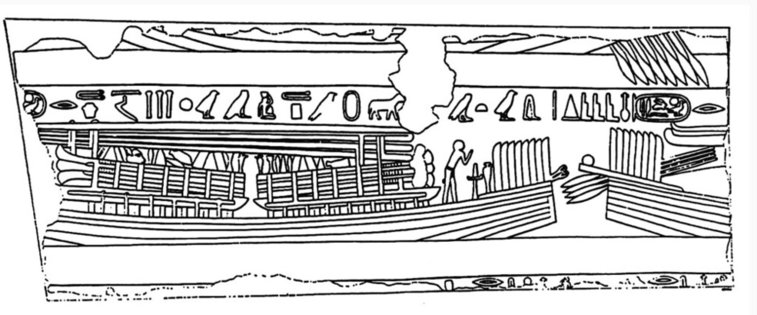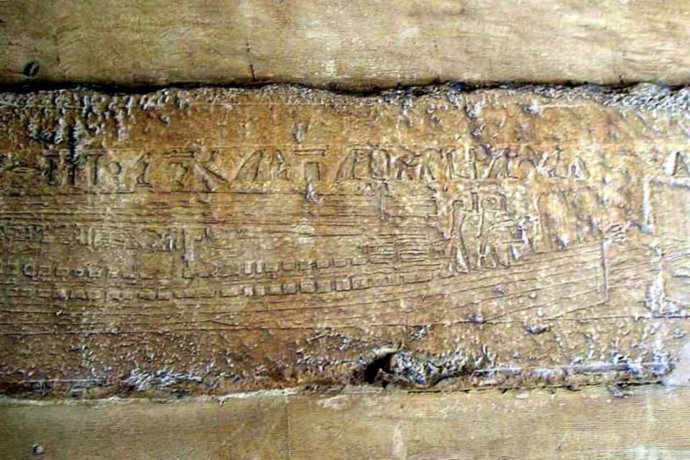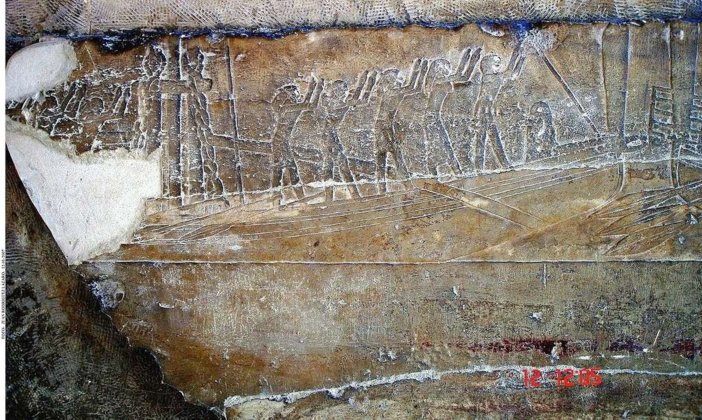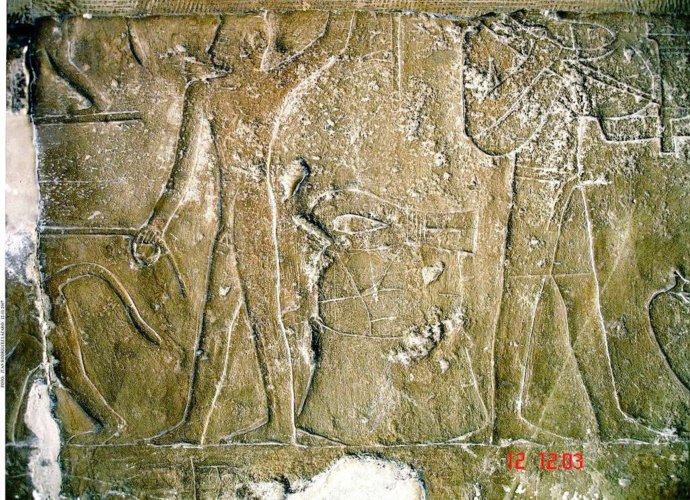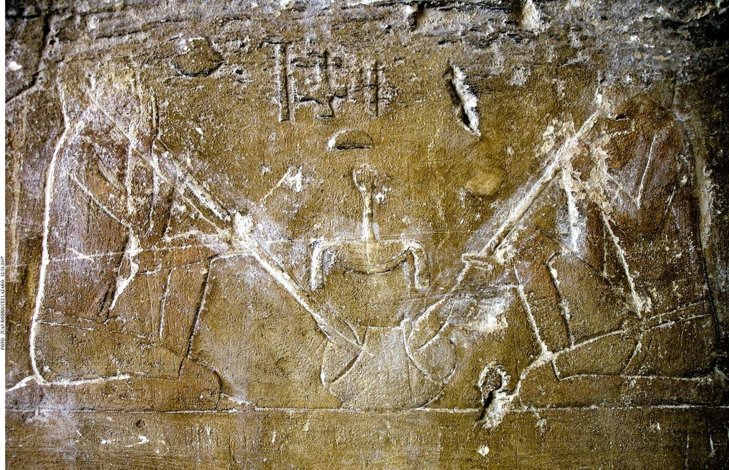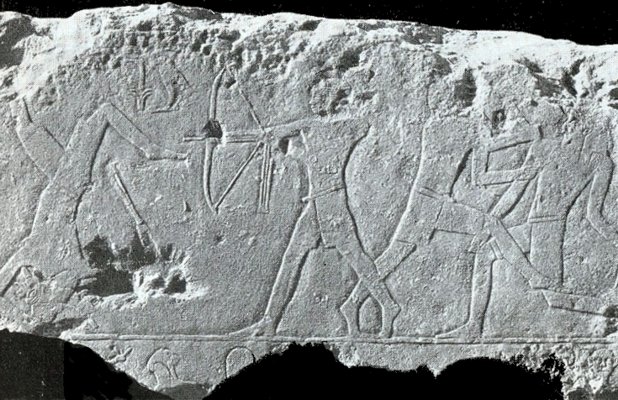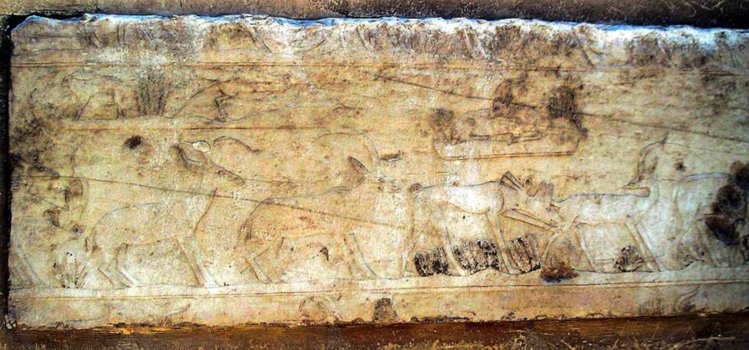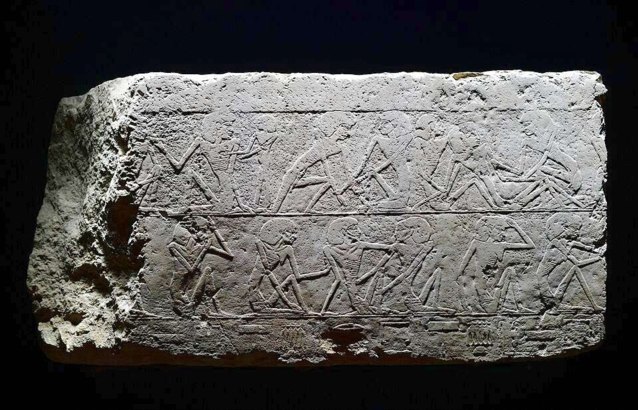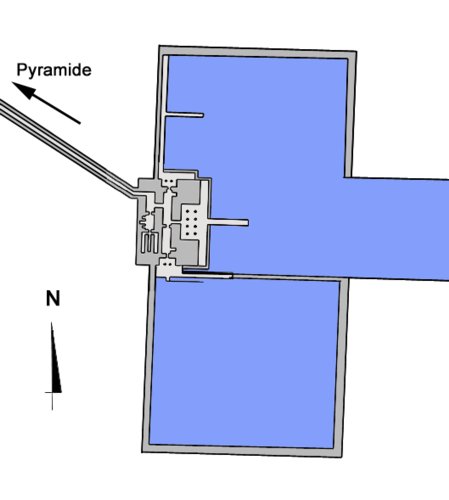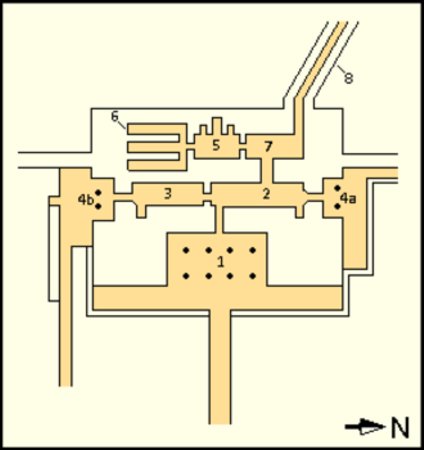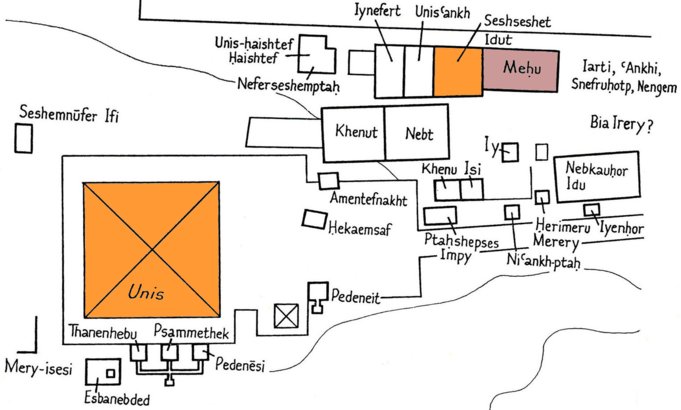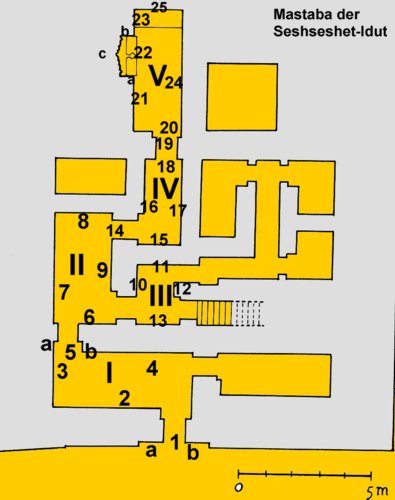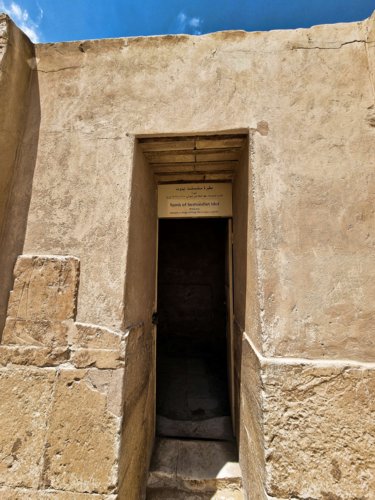Die Baumeister der Unas-Pyramide
verwendeten Tura-Kalkstein als Verkleidung für die Pyramide, die aber außer
von wenigen heute nicht mehr gut erhalten geblieben ist. In den untersten
Schichten ist sie teilweise noch in situ erhalten. Hier fanden die
Forscher auf der Südseite eine Inschrift aus der 19. Dynastie von Prinz
Chaemwese (Sohn von Ramses II.), welche der Prinz hier an der
Pyramidenverkleidung anbringen ließ. Der Archäologe Jean Ph. Lauer konnte
sie aus Fragmenten neu zusammensetzten.
Reste der erhaltenen
Restaurierungsinschrift
auf der Südseite der Unas-Pyramide von Prinz Chaemwaset |
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro
- all rights reserved - |
Chaemwese berichtet in dieser
Inschrift über die von ihm - im Auftrag seines Vaters - vorgenommenen
Restaurierungsarbeiten an der Unas-Pyramide. Die Inschrift, die J. P. Lauer
1973 an der Südseite der Pyramide machte, befand sich auf zwei mit großen
Hieroglyphen beschrifteten Verkleidungs-Blöcken, die exakt zusammenpassten.
Weitere Fragmente ließen sich hinzufügen und in situ fand man auf der
Südseite der Pyramide auf einem Verkleidungsblock eine dazugehörige weitere
Inschriftenzeile. Diese bildeten das untere Ende einer Inschrift, die - wie
Marie Felix Drioten gezeigt hat - die kompletteste bekannte Version eines
Textes darstellt, der im Auftrag von Ramses II. an bestimmten Bauswerken der
memphitischen Nekropole angebracht wurde (auf Anregung seines Sohnes
Chaemwese, der Hohe Priester des Ptah zu Memphis war und sich häufig in den
Restaurationstexten aus der Zeit Ramses II. findet). Chaemwese berichtet hier,
dass er sich auf Befehl seines Vaters Ramses II. um die Wiederherstellung
dieser Pyramide gekümmert habe und dabei den Namen des König Unas, der
damals nirgendwo an dem Bauwerk mehr zu finden war, für jeden wieder
sichtbar eingehauen habe.
|
Königsbefehl:
„ ………. Seine Majestät befahl, den [………..
Chaemwaset] zu beauftragen, den Namen des Königs (von Ober – und
Unterägypten (Unas)| dauerhaft zu machen. Sein Name wurde nun
nicht auf seinem (Pyramiden)Grab gefunden, insoweit als [Chaemweset] wünschte,
die Denkmäler des Königs von Oberägypten und der Könige von Unterägypten
trefflich zu
machen wegen ihrer Taten, deren Festigkeit im Verfall begriffen war.
Er setzte den Befehl für sein Gottesopfer fest auf [ … ] gefunden
auf/an [ … ] Chaemweset [mit seinem Wasser, im für ihn/es zu machen
[ … ] mit Gebieten und Menschen [ … ] aus den beiden Scheunen des
Königs, nach dem, was gefunden wurde unter [ … ] Chaemweset
…………… “
(Text aus Silke Grallert: Bauen-Stiften-Weihen)önigsbefehl:
|
Teile ähnlicher Inschriften
fanden sich mittlerweile auch auf den Außenwänden des Sonnenheiligtums des
Niuserre, an der Pyramide des Sahure,
des Userkaf, der Mastaba El Faraun
und im Südteil des Djoser–Bezirks. Der Architekt Mohammed Raslau brachte
1976/77 (im Auftrag der Altertümerverwaltung) die Blöcke wieder auf der
Südseite der Pyramide an.
Ob die Spolien, die aus dem Totentempel von König
Isesi stammen und in der inneren Struktur auf der Südseite der Pyramide
wiederverwendet wurden, bereits original verbaut waren, oder erst bei der Restaurierung
von Prinzen Chaemwese hier zur Verwendung kamen, kann nicht eindeutig
entschieden werden. Anderseits fanden sich Reliefblöcke die aus dem
Unaskomplex stammen in der Pyramidenanlage Amenemhets
I. in Lischt verbaut.
|

|
Wiederverwendete Blöcke
aus dem Totentempel von König Isesi
Auf der Südseite der Pyramide wurden Blöcke
gefunden, die aus dem Totentempel von König Djedkare Isesi stammen und
in der inneren Struktur der Unas-Pyramide wiederverwendet wurden.
(siehe PM "Topographische Bibliographie
altägyptischer Hieroglyphentexte, Reliefs und Gemälde" III. Teil
2 1978, S. 421)
Bild: Courtesy to Heidi Kontkanen, Finnland
- all rights reserved - |
|
Die
Pyramide in Zahlen
(Zahlen
nach Mark Lehner: Geheimnis der Pyramide u. Lexikon der
Pharaonen/Schneider)
|
| Name
in der Antike: |
"Schön
sind die Stätten des Unas" (Nfr-swt-wnjs) |
| ursprüngliche
Höhe |
43
m (82 Ellen) |
| heutige
Höhe: |
ca.
19 m |
| Basismaß |
57,75
x 57,50 m (110 Königsellen) |
| Volumen |
47.390
m³ |
| Neigungswinkel: |
56
° 18' 35"(steilste Königspyramide dieses Zeitraums) |
| Kern
der Pyramide |
6
Stufen aus grob behauenem Kalkstein (lokale Steinbrüche) |
| unterirdische
Kammer: |
3
- Nischenkammer, Vorkammer und Grabkammer |
| Königinnenpyramiden: |
keine
(dafür -Doppelmastaba seiner beiden Ehefrauen, Nebet und Chenut) |
| Kultpyramide |
ja - Basismaß: 11,5 m -
Seitenneigung 63 °; Höhe 11,5 m |
| Nordkapelle |
ja, (weitestgehend
zerstört), 1 Raum mit Altar und Stele - |
| Schiffsgruben |
ja - 150 m östlich der
Pyramide; zwei 45 m lange Barkengräber / Barken total zerfallen |
| Totentempel, Aufweg,
Taltempel |
ja |
Die
Unas-Pyramide erscheint uns heute nur noch als Ruinenhügel. Als Grund dafür
werden der minderwertige, grobe innere Aufbau und die heute nicht mehr
vorhandene Verkleidung angeführt. Die Unas-Pyramide ist deutlich schlechter
erhalten als die älteren Pyramiden aus der 4. Dynastie (Cheops, Chephren und
Mykerinos), da das grobe Kernmauerwerk den erosiven Einflüssen im Vergleich
zu den qualitativ höherwertigen Mauerwerk aus der 4. Dynastie nicht
standhalten konnte (siehe Miroslav Verner: Die Pyramiden, Reinbek 1997, S.
369ff, Pyramide des Unas und Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden.
Vom Ziegelbau zum Weltwunder, Mainz 1997, S. 184-185).
Der Pyramidenkomplex des Unas
besitzt alle fünf wesentlichen Komponenten einer Totenkultanlage.
-
dem Taltempel
-
dem Aufweg
-
dem Totentempel
-
einer Kultpyramide
-
und der Hauptpyramide
Unas Monument umfasst alle diese
fünf Elemente - außerhalb der Mauern des Komplexes befindet sich die
Kultpyramide, die Königinnen Mastaba, der Aufweg, der Taltempel und die
Bootsgruben. Somit entspricht die Ausführung des Komplexes im Großen und
Ganzen dem Standard-Pyramidenkomplex, wie er sich seit der Sahure-Pyramide
etabliert hatte (4+5).
Die Pyramide des Unas hat eine
Basislänge von 57,75 x 57,50 m (110 Königsellen) in der Grundfläche und war
ursprünglich 43 m hoch. Sie war mit einer Seitenneigung von 56 ° die
steilste Königspyramide dieses Zeitraumes (4). Ihr Kern besteht aus sechs
Stufen, die aus grob behauenen Kalkstein besteht, der aus den lokal
anstehenden Steinbrüchen stammt. Mit zunehmender Höhe nimmt die Größe der
Steinblöcke ab. Der Kern selber war mit exakt behauenen und geglätteten
Steinen aus feinem Tura-Kalkstein verkleidet, von der aber heute nur noch
wenige Steine der untersten Schicht erhalten geblieben sind, der Rest fiel dem
Steinraub zum Opfer - wie viele der damaligen Pyramiden.
|
Aufbau des Unas-Komplexes
Die Pyramide, der Totentempel und die
Kultpyramide wurden von einer 7 m hohen Umfassungsmauer umgeben. Diese
war von der nordöstlichen bis zur nordwestlichen Ecke etwa 86 m (282
ft, 164 cu) lang und erstreckt sich über 76 m (249 ft, 145 cu) von
Norden nach Süden
(Quelle: Labrousse, Lauer & Leclant 1977 - Le temple haut du
complexe funéraire du roi Ounas, Cairo: Institute francais
dàrchéologie orientale du Caire).
|
|
Zeichnung: Courtesy to Franck Monnier, Wikipedia
19. 7. 2009
- gemeinfrei -
- bearbeitet (beschriftet) von Nefershapiland - |
Unterbau
Der Eingang zur Unas-Pyramide
befindet sich auf Bodenniveau im gepflasterten Hof an der Nordseite der
Pyramide. Dieses unterscheidet sich von dem der meisten anderen Pyramiden, wo
dieser sich in der Pyramidenseite befindet.
|
Moderner Eingang zu der Unterkonstruktionen der
Pyramide
(unten links) |
| Bild: Courtesy to Sebi, Wikipedia, public domain |
Die Unterstruktur der Pyramide ähnelt der von Djedkare
Isesi, dem Vorgänger von König Unas. Die Grabkammer befand sich im Westen,
ein 7,30 (24ft) x 3,08 (10,1 ft) großer Raum, in dem sich der Sarkophag des
Herrschers befand. Das Dach der Vorkammer als auch der Grabkammer war
giebelförmig - ähnlich wie bei den früheren Pyramiden dieser Zeit.
|
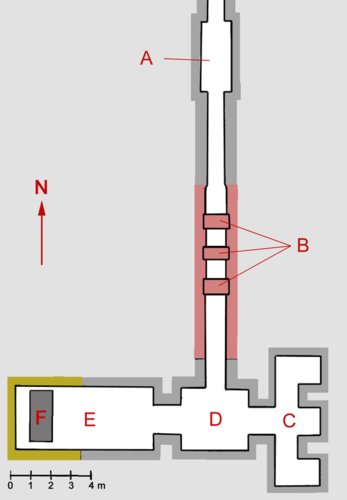
|
Gangsystem der Unas-Pyramide
A: Gangkammer / Korridor
B: Sperrsteine
C: Nischenkammer
D: Vorkammer
E: Grabkammer
F: Sarkophag (grau)
Kalkstein: rot
Granit: grün-gelb (Alabaster)
Vom Eingang aus führt eine
14,35m lange und 22° geneigte Passage zu einer Gangkammer, die unter
der Pyramide liegt (2,47 x 2,08 m) und von wo eine ebene, 14,10 m lange
Fortsetzung zu den Kammern im Pyramiden-Inneren führt. In dieser
Passage befinden sich 3 Fallsteinsperren aus Granit (B). Im Bereich um
die Sperren herum besteht die Wandverkleidung ebenfalls aus
Granit.
Die Fortsetzung des Gangs hinter der Sperre führt zur Vorkammer (D),
die sich zentral in der Mitte der Pyramide befindet und Abmessungen von
3,75 x 3,08 m besitzt. In östlicher Richtung erreicht man von dort die
Drei-Nischen-Kammer (C), die 6,75 x 2 m misst - in westlicher Richtung
die Grabkammer (E). |
Zeichnung:
Unas Pyramid Substructure.png
Autor: GFDL - Wikipedia
User: Schreiber 18. 7. 2009
nach Kurt Sethe: altägyptische Pyramidentexte
Lizenz: CC
BY-SA 3.0 |
Vor der Westwand der Grabkammer steht
noch heute der Sarg des Königs, der aus grauschwarzer Grauwacke und nicht aus
Basalt gefertigt war, wie man ursprünglich angenommen hatte. Der schon
früher zerbrochene Sarkophagdeckel fand sich nahe dem Eingang zur Vorkammer.
Der Sarkophag selber war zwar unbeschädigt - sein Inhalt aber gestohlen. Vom
königlichen Begräbnis haben sich nur geringe Reste erhalten. Eine
Kanopentruhe war einst am Fuße der südöstlichen Ecke des Sarges begraben
worden (siehe Verner, 2001). Alles was vom königlichen Begräbnis übrigblieb
sind Teile einer Mumie, einschließlich des rechten Arms, des Schädels (zwei Schädelknochen)
und des Schienbeins sowie die Holzgriffe von zwei Messern, die bei der
Mundöffnungszeremonie verwendet wurden. Das Vorhandensein von Haut und Haaren
an dem Schädelteil machen jedoch eine Zuordnung der Mumienteile in die 5.
Dynastie für sehr unwahrscheinlich - obwohl lt. der Beschriftung des Museums
diese von König Unas stammen sollen. Vermutlich handelt es sich hier um eine
viel spätere Sekundär-Bestattung. In den Aufzeichnungen der Ausgräber ist
auch nirgends etwas von "menschlichen Überresten" die Rede.
|
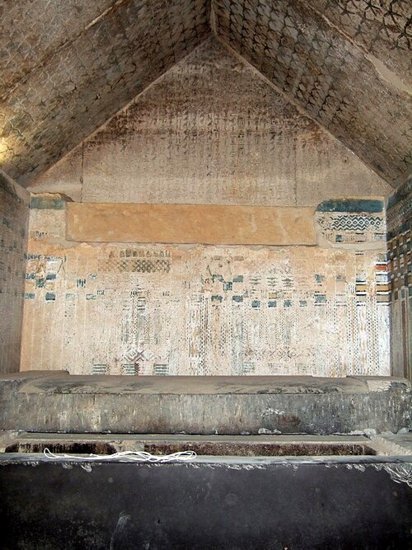
|
Die Grabkammer
mit dem Sarkophag im Vordergrund
Das Bild zeigt den Sarkophag (im Vordergrund), das Motiv der
königlichen Palastfassade, Inschriften am Westgiebel und die
Sternendecke der Grabkammer. |
Bild:
Burial
Chamber in Unas Pyramid
Autor: Vincent Brown, Wikipedia, 4. 10. 2011
Lizenz: CC
BY-2.0 |
|
Sarkophag in der Grabkammer aus Grauwacke
Der Sarkophag war zwar unbeschädigt - der Inhalt
aber nicht mehr vorhanden. Eine
Kanopentruhe war einst am Fuße der südöstlichen Ecke des Sarges begraben
worden (siehe Verner, 2001) |
Bild: Courtesy to Heidi Kontkanen, Finnland
- all rights reserved - |
|
Palastfassaden-Motiv mit Scheintüren |
| Die Südwand der Grabkammer von König Unas zeigt
die Palastfassade oder das Motiv einer Scheintür. Dieses
"Scheintürmotiv", das den Sarkophag umgibt, könnte als
Zugangsmöglichkeit an der Nord-, West und Südseite der
Sarkophagkammer angesehen werden. Diese drei alternativen Ausgänge
ergänzen den Durchgang am östlichen Ende der Kammer und ermöglichen
den Zugang für den Verstorbenen aus allen vier Himmelsrichtungen.
Ganz rechts unten auf dem Bild ist der Deckel des Sarkophages zu
sehen |
Bild: Burial
Chamber in Unas PyramidPalastfassade
Autor: Vincent Brown, Wikipedia, 18. 10. 2011
Lizenz: CC
BY-2.0 |
Die Wände
der Grabkammer waren mit feinem Tura-Kalkstein ausgekleidet - die Wände
um den Sarkophag des Unas herum waren mit weißem Alabaster verkleidet, der
eingeritzt und bemalt war, um die Türen der Fassade des königlichen Palastes
darzustellen, welche den östlichen Durchgang ergänzte. Sie erlaubten es dem
König (symbolisch) das Grab in jede Richtung zu verlassen. Die Wände
scheinen Blöcke zu enthalten, die wohl von einem der Cheops-Bauwerke
wiederverwendet wurden, möglicherweise von seinem Pyramidenkomplex in Gizeh.
Die Decke der Grabkammer war blau mit goldenen Sternen bemalt, um den
Nachthimmel zu ähneln. Die Decke der Vorkammer und des Korridors waren in
ähnlicher Weise bemalt. Die Sterne in der Vorkammer und der Grabkammer
zeigten nach Norden, während die Sterne im Korridor in Richtung Zenit
zeigten. Die restlichen Wände der Grabkammer, der Vorkammer und Teile des
Ganges wurden mit einer Reihe von vertikal geschriebenen Texten beschriftet,
die in Flachreliefs gemeißelt und blau gestrichen waren (Verner, Miroslav
2020, Die Pyramiden: Die Archäologie und Geschichte der ikonischen Denkmäler
Ägyptens, Kairo - Amerikanische Universität und Lehner, Mark 2008 - the
Complete Pyramids, New York: Thames & Hudson).
|
Blick von der Vorkammer in die
Grabkammer
Die Wände der Vorkammer sind mit
Pyramidentexten beschriftet. |
| Bild: Courtesy to the Brooklyn-Museum - public domain
(Bild erstellt 1900) |
Pyramidentexte
Der altägyptische Glaube besagte, dass das
Individuum aus drei grundlegenden Teilen besteht: dem Körper, dem Ka und dem
Ba. Wenn der Mensch starb, trennte sich das Ka vom Körper und kehrte zu den
Göttern zurück, von denen es gekommen war, während das Ba beim Körper
blieb. Der Körper des Individuums, das in der Grabkammer lag, verließ diesen
nie physisch, doch das Ba erwachte, löste sich vom Körper und begann seine
Reise in ein neues Leben. Bedeutsam für diese Reise war das Achet, der
Horizont - eine Verbindung zwischen Erde, Himmel und Duat. Für die alten
Ägypter war das Achet der Ort, an dem die Sonne aufging, und symbolisierte
somit einen Ort der Geburt oder Auferstehung.
In den
Totentexten wird der König aufgefordert, sich im Achet in ein "Ach"
zu verwandeln. Das Ach, wörtlich "wirksames Wesen", war die
wiederauferstandene Form des Verstorbenen, die durch individuelles Handeln und
rituelle Durchführung erreicht wurde. Die Funktion der Texte bestand in
Übereinstimmung mit der gesamten Grabliteratur, die Wiedervereinigung von Ba
und Ka des verstorbenen Herrschers zu ermöglichen, die zur Verwandlung in ein
Ach führte und ewiges Leben unter den Göttern im Himmel zu sichern.
Auf der
Nord- und Südwand der Grabkammer befinden sich Zaubersprüche, die dem Opfer-
und Auferstehungsritualen gewidmet sind. Die Texte auf der Ostwand enthalten
Sprüche, welche die Kontrolle des Königs über seinen Lebensunterhalt in
Form einer Antwort auf das Opferritual beteuern. Die Texte zum Opferritual
setzen sich an der Nord- und Südwand des Durchgangs fort und teilen das
Auferstehungsritual, das an der Südwand endet.
|
Pyramidentexte zum Opferritual an der Nordwand
der Grabkammer |
| Die Texte enthalten Zaubersprüche und
Beschwörungen, welche die Seele des Verstorbenen auf ihrer Reise ins
Jenseits helfen sollten. Die sog. Pyramidentexte geleiten die Seele
des Königs sicher ins Jenseits. An den unterirdischen Wänden der
Unas-Pyramide sind insgesamt 283 Zaubersprüche zu finden. |
|
Bild:
Pyramid
Text in Unas Pyramid 2017
Autor: Aidan McRae Thomson, Wikipedia 13.10.2017
Lizenz: CC
BY-SA 2.0
|
Vorzimmer
und Korridor wurden hauptsächlich mit persönlichen Texten beschriftet. Die
West-, Nord- und Südwände des Vorzimmers enthalten Texte, die sich
hauptsächlich mit dem Übergang vom Reich der Menschen ins nächste und mit
dem Aufstieg des Königs in den Himmel befassen. Die Ostwand enthält einen
zweiten Satz Schutzzauber, beginnend mit dem "Kanibalenhymnus", in
dem Unas die Götter verzehrt, um ihre Macht für seine Auferstehung zu absorbieren.
Der Serdab blieb unbeschriftet. Der südliche Abschnitt der Wände des
Korridors enthält Texte, die hauptsächlich mit der Auferstehung und
Himmelfahrt des Verstorbenen befassen.
Auf der Nordseite
(Eingangsseite) befand sich auf Bodenniveau beim Eingang zum absteigenden
Korridor ins Innere der Pyramide die aus einem einzigen Raum bestehende
"Nordkapelle". Diese ist heute zwar weitestgehend zerstört und ist
nur noch anhand von Versatzspuren nachweisbar (siehe 3. - 4. und 5), diese
genügen jedoch für eine Rekonstruktion. Der Bau ist mit seiner Längsseite
Ost-West ausgerichtet und hat die Maße 14 x 10 Ellen. An der südlichen - an
der Pyramide anliegenden - Wand der Kapelle stand einst eine Stele und davor
ein Altar - in der Form des hieroglyphischen Zeichens für "hetep" (Htp).
Die
Funktion der Nordkapelle im Pharaonenkult ist noch nicht endgültig geklärt,
sie diente vermutlich zu rituellen Handlungen im Zusammenhang mit dem
Grabeingang und als sichtbares Monument desselben.
|
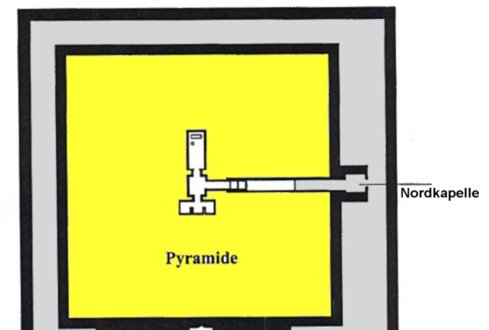
|
Die Nordkapelle am originalen Eingang
Die kleine Kapelle befindet sich im Norden der
Pyramide - unmittelbar am Eingang gelegen und bestand nur aus einem
einzigen Raum, ist jedoch heute vollständig zerstört.
Plan: Dagmar Stockfisch 2003, –
nach Labrousse/Moussa, BdE 111, fig. 2
- modifiziert von Nefershapiland - |
Während der 5. Dynastie
bildeten sich die folgenden Merkmale für Kultpyramiden aus: Die Innenräume
sind durchgehend achsenorientiert T-förmig angelegt und Bemerkenswerterweise
nie verkleidet. Ab Userkauf wird die Kultpyramide in den königlichen
Pyramidenanlagen integriert und direkt zugänglich gemacht und gehört nunmehr
- im Unterschied zur 4. Dynastie als Bestandteil zum Totentempel. Seit der
Regierungszeit von König Unas liegt der Winkel der Kultpyramide regelmäßig
bei 63° - wobei dann die Basislänge ungefähr der Höhe (ca. 22 Ellen)
entspricht (Quelle: die Kultpyramide, Überlegungen zur
Entwicklungsgeschichte, Bedeutung und Funktion, Julia Budka)
Die kleine Kultpyramide
des Unas befindet sich südöstlich der Pyramide - innerhalb der
Einfassungsmauer (1). Die Basismaße sind 11,5 m und haben eine Seitenneigung
von 63° und eine Höhe von 11,5m. Als Baumaterial diente ebenfalls Kalkstein,
der aus den lokalen Steinbrüchen stammt. Die Verkleidung bestand aus feinem
Tura-Kalkstein. Ein Eingang von Norden her führt zu einer T-förmigen Kammer,
in welcher aber keinerlei Spuren einer Bestattung gefunden wurden. Im
Gegensatz zur Hauptpyramide ist der Unterbau der Kultpyramide nicht dekoriert
oder beschriftet. Der Oberbau der Kultpyramide ist größtenteils abgetragen
(1).
|
Reste der heute verschwundenen Kultpyramide
König Unas |
| Blick nach Osten auf die Überreste der verlorenen
Satellitenpyramide (Kultpyramide). Rechts die Platten des absteigenden
Eingangskorridors an der Nordseite. |
Bild: Courtesy to Juan R.
Lazaro 12. Jan. 2007
- all rights reserved - |
|
Reste der heute verschwundenen Kultpyramide
König Unas |
| Grabanlage von König Unas mit Blick auf Osten mit
den Überresten der Kultpyramide (Bildmitte bis links). |
Bild: Courtesy to Juan R.
Lazaro 12. Jan. 2007
- all rights reserved - |
Der Totentempel von
Unas besitzt einen Grundriss, der mit dem seines Vorgängers Djedkare Isesi
vergleichhar ist - mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Ein Tor aus Rosengranit
trennt das Ende des Aufweges von der Eingangshalle. Es trägt den Namen und
die Titel von König Teti, was darauf hindeutet, dass er das Tor erst nach dem
Tod von Unas hat errichten lassen. Auch die Fassadentürme bei Unas haben nun
bereits eine pylonartige Fassade mit Hohlkehlenabschluss und Rundstab an den
Ecken.
Der Totentempel
wurde in den Jahren 1974 bis 1976 von einer Mission des "MAFS"
(Mission Archéologique Franco-Suisse de Saqqara) unter der Leitung von
Jeam-Phi´llipe Lauer und Jean Leclant sowie ab 1990 von Audran Labrousse
untersucht.
Durch das
Eingangstor betrat man das große langgestreckte Vestibül, das sog. "pr–wrw".
Die Eingangshalle (2 im Plan) besaß eine eine gewölbte Decke und einen mit
Alabaster gepflasterten Fußboden und die Wände im Raum waren mit
Reliefmalereien geschmückt, welche Szenen mit dem Darbringen von Opfergaben
darstellten.
|
Die Überreste des granitenen Eingangsportals |
Rechter Pfeiler mit Inschrift und Kartusche Unas |
| Den Zugang zum Totentempel in der Mitte
der Ostfassade bildete ein Tor aus Rosengranit mit einer großen
Inschrift, die den Namen und die Titulatur von König Teti - dem
Nachfolger von Unas enthält. Dieses ist ein untrüglicher Beweis
dafür, dass dieser Teil des Tempels erst nach dem Tod des Herrschers
fertiggestellt wurde und es somit wohl keinerlei Spannungen zwischen
den beiden Dynastien gab. |
Bild: Courtesy to Juan Rodriguez Lázaro 2007
- all rights reserved - |
Bild: Courtesy to Juan Rodriguez Lázaro 2007
- all rights reserved - |
Der
offene Säulenhof:
Vom "pr-wrw"
(Eingangshalle/Vestibül) aus gelangte man in einen offenen Säulensaal (auf
ägyptisch "Wsxt–Hof genannt) (3 im Plan), in dem 18 rosafarbene
Granitpalmensäulen (4) - zwei Säulen mehr als im Komplex von Djedkare
Isesi - das Dach eines Chorumgangs trugen. Diese waren schlanker und höher
als ihre älteren "Schwestern" bei Sahure oder Djedkare. Diese
Überdachung diente als Schutz der ehemals bemalten Reliefdarstellungen der
Hofwände.
|
Palmenförmige Granitsäule aus den Peristylhof
des Totentempels von König Unas in Saqqara (aus Assuan-Granit)
- heute im Louvre E 10959 - |
|
Bilder: Courtesy Juan R. Lázaro (24.7. 1993)
- all rights reserved - |
|
Reste eines zerbrochenen Kapitells einer
Säule aus Rosengranit.
- vor der Ostseite der Hauptpyramide -
Das Granitfragment (links neben dem Kapitell) ist der
Rest eines Säulenabakus, d. h. der oberste Abschluss einer Säule. In
den Säulenabakus wurden zwei Bohrungen eingebracht, welche zur Aufnahme
hölzerner Zapfen dienten, welche zusammen mit dem Säulenkapitell eine
enge Verbindung eingingen (vielleicht gegen Erdbeben?). Die Holzzapfen
verbanden die steinernen Dachbalken fest mit der Säule |
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (1997)
- all rights reserved - |
|
Blick auf die Hauptachse des Unas-Totentempels
vom westlichen Tor der Eingangshalle aus gesehen
Im Vordergrund (Mitte) die Ruinen des Peristylhofes
(offener Säulenhof) und im Hintergrund die Reste der Unas-Pyramide. |
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (1997)
- all rights reserved - |
Von diesen
ursprünglich 18 Palmsäulen aus Rosengranit ist heute keine mehr in situ
erhalten. Einige Exemplare befinden sich in verschiedenen Museen der Welt
(Louvre, Inv.-Nr. E 10959 und Kairo, Inv.-Nr. JE 35131) sowie in Tanis. Das
Fragment einer Beamtenbiografie berichtete, dass die Granitsäulen per Schiff
aus Elephantine nach Saqqara transportiert wurden (H. G. Fisher: A Speedy
return from Elephantine: in Journal of Egyptian Archaeology 61, 1975, S.
33-35, pl. XVI, 1). Weitere Säulen wurden im Britischen Museum (BM Inv.-Nr.
1385 - diese trägt keine Inschrift) ausgestellt. Reliefdekorationen, die sich
früher im Innenhof befanden, wurden auch in späteren Projekten
wiederverwendet, wie das Vorhandensein von Reliefs von Unas im
Pyramidenkomplex von Amenemhat I. in El-Lisht zeigt (siehe M. Verner, S. 335).
Es wurde auch das Fragment eines Architravs, welches ebenfalls den Namen des
Unas trug, gefunden. Die Inschriften auf den südlichen Säulen nennen
Titulatur und Name des Königs und bezeichnen ihn als "geliebt von
Nechbet" - auf den nördlichern Säulen wird "er geliebt von WADt
" bezeichnet.
|
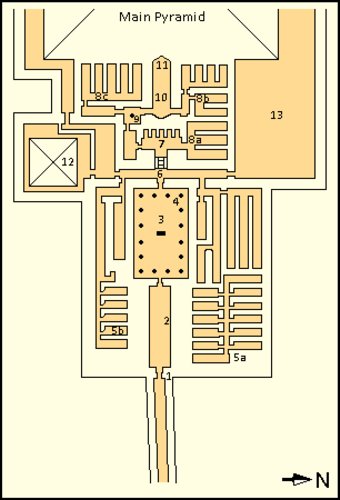
|
Plan Totentempel Unas
1. Granitportal, gebaut von Teti
2. Eingangshalle mit (5a+b) Abstellräume im Norden und Süden (pr-wrw)
3. Innenhof (offener Säulenhof) mit
4. 18 Granitsäulen
6. Querkorridor
7. Kapelle mit fünf Statuennischen
8a+b. Vorratsräume
9. Antichambre carée mit Mittelsäule
10. Opferhalle mit
11. Scheintür mit Schutzinschrift
12. Kultpyramide
13. Innenhof, der den Pyramidenkomplex umgibt.
Der Bodenbelag des Totentempels bestand teilweise aus Kalkstein -
stellenweise aus Alabaster (Vestibül und bei Teilen des inneren
Tempelbereichs) - vereinzelt haben sich noch ein paar granitene
Türschwellen erhalten. Die Mauern des Tempels bestehen aus
Kalksteinblöcken - diese ruhen aber nicht mehr wie früher auf einem
Granitfundament.
Das Vestibül (2) besaß eine Pflasterung aus
Alabaster und einer gewölbten Decke. Der Raum maß 10 x 37 Ellen = 5,20
x 19,24m. Die Wände bestanden aus Kalkstein, die an den Seiten mit
Darstellungen von Opferdarbringungen geschmückt waren. |
Bild:
Unas Mortuary temple
Autor: Mr. Mddude, Wikipedia 3. Nov. 2018
Lizenz: CC
BY-SA 4.0 |
Nördlich und südlich der
Eingangshalle und des Säulenhofes befanden sich die Vorratsräume, die
regelmäßig mit Opfergaben für die königlichen Totenkult bestücke wurden.
Der Totenkult hatte in der 5. Dynasty einen erweiterten Einfluss. Durch die
unregelmäßige Platzierung dieser Vorratsräume waren die nördlichen
Lagerräume doppelt so zahlreich wie die südlichen. Diese Räume wurden in
der Spätzeit für Bestattungen genutzt, was durch das Vorhandensein großer
Schachtgräber belegt wird. Am anderen Ende des Hofes befand sich ein
Quergang, der eine Kreuzung zwischen dem Säulenhof im Osten und dem inneren
Tempel im Westen bildete, mit einer Kultpyramide im Süden und einem
größeren Hof, der die Pyramide im Norden umgab (6).
|
Blick auf die Mittelachse des Totentempels
nach Osten
- gesehen vom intimen Teil des Totentempels aus -
Im Vordergrund Granitblöcke vom Boden des Westtores
(C) zwischen 18-Pfeilerhof und Querhalle (6) zum intimen Teil des
Totentempels. Im Hintergrund Reste der Granitpfosten des Eingangsportals
zum Totentempel (1). |
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12.1.2007)
- all rights reserved - |
Vom Säulenhof
aus führt am anderen Ende (Osten) ein Eingang in den inneren (privaten) Bereich des
Tempels. Zunächst verläuft ein Quergang (6), der sowohl zu den
Lagerräumen, dem Pyramidenhof im Westen, der Kultpyramide und zur Fünf-Nischenkapelle
führt. Der Zugang zum "intimen" Teil des Totentempel erfolgt über eine kleine
Treppe hinter dem Quergang, die zu einer heute zerstörten Kapelle mit 5
Statuennischen führt. Von dort aus gelangt man rechts zu weiteren
Magazinräumen (8a) und nach links zur Vorkammer (9), von der praktisch nichts
mehr erhalten ist und schließlich zur
Opferhalle (10), die ebenfalls von weiteren Magazinkammern flankiert wird. Die
"Antichambre carrée" (ein kleiner Vorraum) trennte die Kapelle von
der Opferhalle, von der nur noch eine Scheintür aus Rosengranit existiert. Der Raum misst 4,20 m (4,8 cu) auf jeder Seite und ist damit
die kleinste Kammer des Alten Reiches - ist aber heute weitgehend zerstört.
Man betrat diese Vorkammer ursprünglich durch eine Tür auf der Ostseite. Der
Raum enthielt noch zwei weitere Türen, die zur Opferhalle (10) und zu den
Magazinräumen (8a+b) führte.
In dem Raum befand
sich eine einzige, zentrale Säule aus Quarzit, deren Fragmente im
südwestlichen Teil des Tempels gefunden wurden und die aus dem Steinbruch von
Gebel Ahmar (in der Nähe von Heliopolis) stammen. Reste einer Scheintür mit
einer Inschrift über die Seelen von Nechen und Buto (11) befinden sich heute
im Ägyptischen Museum Kairo (Quelle: M.Verner 2001, Die Pyramiden,
Amerikanische Universität Kairo).
|
Fragment einer palmenförmigen Säule aus Quarzit
Evtl. handelt es sich hierbei um einen Teil der
einzelnen Säule, welche den quadratischen Vorraum (9) - (Anti-chambre)
des Heiligtums schmückte. |
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12.1.2007)
- all rights reserved - |
In der
zerstörten "Fünfnischenkapelle" (7 auf dem obigen Plan) fanden die
Ausgräber ein Relieffragment (heute im Museum Kairo), welches den König
zeigt, wie er von einer Göttin gesäugt wird und damit in der Gemeinschaft
der Götter aufgenommen wird.
|
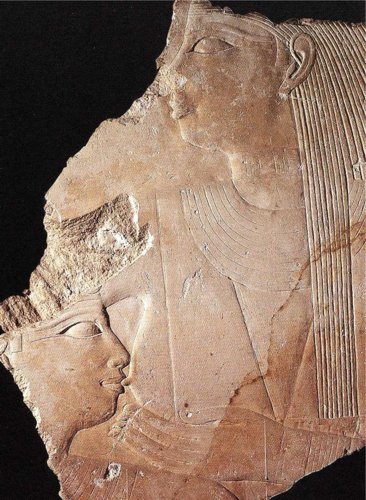
|
Unas wird von Göttin gesäugt
Fragment eines Reliefs, welches König
Unas bei der Säugung durch eine unbekannte Göttin zeigt.
Gefunden in der 5-Nischen-Kapelle
seines Totentempels. Heute befindet sich das Fragment im Museum Kairo.
Bildautor unbekannt. |
Weitere Relieffragment aus dem
Totentempel (in situ) belegen ein Dekorationsprogramm, welches dem der
älteren Abusir-Tempel gleicht - auch die Qualität der Reliefs hat den hohen
künstlerischen Standard gewahrt.
|
Fragment einer EdF-Szene im Totentempel von
König Unas
König Unas massakriert einen am Boden liegenden
Feind. Eine typische "Erschlagen-der-Feinde-Darstellung".
Material Kalkstein - H. 0,50 x L. 1,50 x T. 0,72 cm
|
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (August 1987)
- all rights reserved - |
|
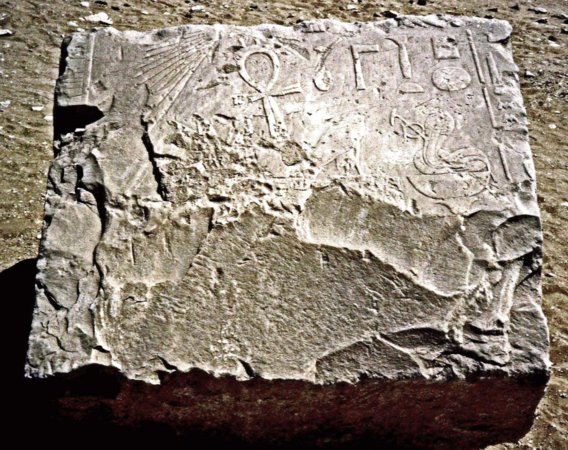
|
Block aus Totentempel - in situ
Block aus dem oberen Teil einer Szene mit
dem Bild von König Unas. Ein Teil der Inschrift mit seinem Namen
"Horus Was[tawy]" ist noch zu lesen.
Material: Kalkstein
Höhe: 0,70 x B. 1,20 x max. Tiefe: 0,62 m
|
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (August 1987)
- all rights reserved - |
| Doppelmastaba der Königinnen |
Nordöstlich der Unas-Pyramide befindet sich
die große Doppelmastaba von Königin Nebet und Königin Chenut - den Frauen
von Unas. Beide Mastabas haben den gleichen Grundriss und die gleiche
Anordnung, was die Gleichstellung der beiden Grabstätten widerspiegelt. Das
Grab von Chenut im Westen ist stark zerstört - Nebets Grabstätte Osten
hingegen ist relativ gut erhalten und einen Blick wert. Die Mastabas hatten
eine ursprüngliche Länge von 49 m und eine Breite von 22 m und eine Höhe
von 4 m.
Die völlige Schmucklosigkeit der leicht geböschten
Fassaden, die aus schweren, ungefähr 80 cm hohen und bis zu 2,50 m langen
Blöcken aus Kalkstein bestehen, entspricht der Einfachheit des Grundrisses.
Das Doppelgrabmal hat zwar äußerlich die Form einer Mastaba, doch liegt es
in unmittelbarer Nähe zur Königspyramide und ihrer Kultanlagen und weisen -
soweit erkennbar - alle wesentlichen Merkmale eines Königinnentempels auf:
-
Eingangsvestibül
-
offener Hof
-
einen Statuenraum - mit ungewöhnlicherweise 4
Nischen
-
Totenopferraum
-
und doppelstöckigem Magazintrakt.
Der gut erhaltene Reliefschmuck
der Nebet-Mastaba zeigt Besonderheiten, die sich nur vor dem Hintergrund der
herausragenden Position der Grabeigentümerinnen erklären lassen - wie z. B.
das "Papyrusrascheln in Anwesenheit" des durch seine Kartusche
vertretenen Königs (Quelle: Peter Munro: Topographisch-hist. Einleitung: Das
Doppelgrab der Königinnen Nebet und Khenut, Verlag: von Zabern, Mainz 1993)
|
Doppelpyramide der beiden Königinnen Nebet und
Khenut/Khenut
- nördlich des Pyramidensektors von Unas - |
|
Plan: Courtesy to Juan R. Rodriguez Lázaro,
Flickr-Album
- bearbeitet von Nefershapiland -
Porter & Moss, III. Part 2 (1978), p. 623-625. Pl. LXI |
|
Rekonstruierte Doppelmastaba von Nebet und Chenut
in Saqqara
- im Nordosten der Unas-Pyramide. |
|
Bild: Pyramid
of Unas, Saqqara, Egypt
User: Carole Raddato from Frankfurt, Germany,
Wikipedia, Febr., 2020
Lizenz: CC
BY-SA 2.0 |
Mastaba der Königin
Chenut
Die Königin
Chenut war eine der beiden Ehefrauen von König Unas. Sie gilt als die Mutter
der Königin Iput. Chenut ist in der anderen Doppelmastaba der zwei Königsgemahlinnen
von König Unas in Saqqara bestattet. Die Mastaba wurde von Peter Munro
ausgegraben und publiziert (Peter Munro: Topographisch-historische Einleitung:
Das Doppelgrab der Königinnen Nebet und Khenut (= der Unas-Friedhof
Nord-West. Bd. 1, von Zabern-Verlag, Mainz 1993, ISBN 3-8053-1353-5). Die
westliche Seite ihrer Mastaba ist heute zerstört.
|
Fragmente der Mastaba von Königin Chenut (im Westen) |
Bild: Courtesy to Juan R. Làzaro
(2007)
- all rights reserved - |
|
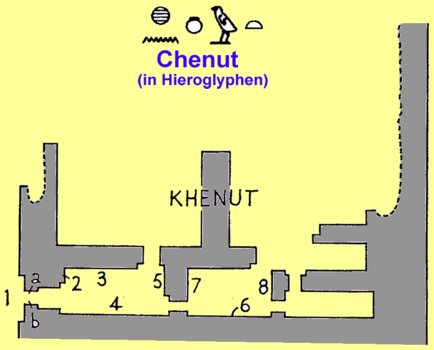
|
Plan der
Mastaba der Chenut
PM
1: Eingang / der Verstorbene (a+b)
Raum I.
PM 2: Reste von 2. Registern - Männer bringen Rinder
PM 3: der Verstorbene in 3 Register: I. Reste von gehenden
und laufenden Männern II. Männer in Booten mit
Menschen mit langen Stangen III. Opferbringer
IV. Männer in Kanus mit Fischen und Nilpferden
im Wasser
PM 4: Zwei Register mit Opferbringer vor einem Anwesen
PM 5: Reg. I.: Männer ziehen ein Schleppnetz.
Raum 2:
PM 6: der Verstorbene, gefolgt von 3 Registern Begleitern
I. Ernte-Szenen II. 4 Boote mit Säcke mit Korn
III. 3 Gruppen Männer mit Truhen (mit Federn drauf)
und Männer die Wasserspende geben.
PM 7: 2 Register: I. ein Mann vor einem Baum II. Opfer-
Bringer
PM 8: Reste von zwei Bullen
Funde: Scheintür mit Verstorbenen, auf dem Boden liegend
|
Plan
oben: nach PM III. Part 2/1978, p. 623-625) - (Topographical Bibliography of
Ancient Egypt Hieroglyphic, Text, Reliefs and Paintings III. Part 2 / Pl.
LXIV)
- all rights reserved - bearbeitet von Nefershapiland -
|
Mastaba der Chenut - Block
aus dem westlichen Teil
Dieser
Steinblock aus dem westlichen Bereich der Chenut-Mastaba zeigt einen
Teil von zwei Registern. Das untere Register zeigt eine Szene mit
Hirten, die eine Viehherde treiben -
|
Bild: Courtesy to
Juan R. Lazaro - Flickr-Album
- all rights reserved - |
Darstellung eines Sumpfdickichts
(5) - Raum I. Nordwand - Register III.
- links die Königstitulatur und die Namenskartusche von König Unas -
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12. Jan. 2007)
- all rights reserved - |
Männer in Kanus mit einem
Opferträger, der eine Ganz trägt
- Mastaba der Königin Chunet - Raum I, Westwand
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12. Jan. 2007)
- all rights reserved - |
(zur Mastaba der Königin Chenut siehe auch: Biografie
Unas / Familie)
Mastaba der Königin Nebet
Der Eingang an der Südostseite von Nebets Mastaba
führt in einen rechte großen Vorraum, dessen Wände mit Reliefs der
verstorbenen Königin geschmückt sind. Der zweite Raum ist der
interessanteste und zeigt Darstellungen der Königin, die in einem Boot durch
die Sümpfe segelt. Links (westlich) von diesem Raum befindet sich ein
geräumiger, offener Hof ohne Dekoration. Direkt dahinter befindet sich ein
zweiter, kleinerer Vorraum mit höchst ungewöhnlichen Wandreliefs, die Nebet
mit ihren Dienern beim Einbringen von Speisen und mit großem Krügen auf
einem beladenen Schlitten (8-9) zeigen. An der Nordwand - über der Tür, ist Nebet
vor Votivgaben sitzend dargestellt.
|
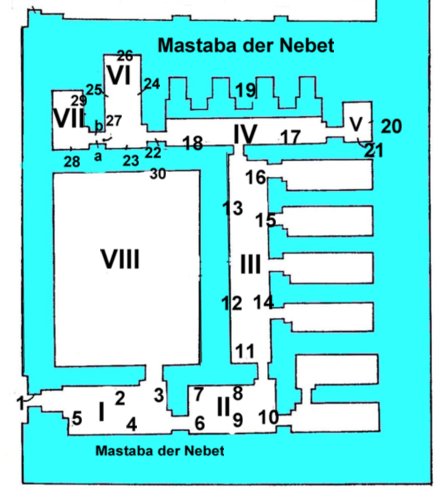
|
Plan der Mastaba der Königin
Nebet
- nach Porter & Moss III. Teil 2.
(1978), Plan LXIV, S. 623 ff -
- bearbeitet von Nefershapiland -
1. Eingang, auf dem Durchgang
die Verstorbene
2. (unterer Teil verloren) - die Verstorbene beim Fischespeeren
- mit Männern in Kanus.
3. unteres Register mit Vieh beim Pflügen und Resten der
zerstörten
Szene darüber. Oben thronende Königin Nebet.
4. die Verstorbene in einer Sumpflandschaft
5. (teilweise unterer Durchgang), die Verstorbene und Register
mit
Männern mit Vögel und Fischen.
Raum II.
6. (unterer Durchgang) - 3 Register mit Szenen beim
Obstpflücken
und Männern mit Früchten
7. Vier Register: I. zerstört II. beim Weinpressen III-IV. beim
Traubenbringen.
8. die Verstorbene in 4 Register mit weiblichen Begleitern hinter
sich
incl. weiblichen Zwergen im unteren Register
und 4 Register mit
Darstellungen, in denen Wein gebracht wird.
9. Nebet mit 3 Registern mit weiblichen Begleitern hinter sich
und
Reg. vor ihr, I. Pflügen und Getreidetreten durch
Schafe mit
"Schäferliedern". II. Melken und
Kalben der Kuh III. Bringen
von Wein auf Schlitten IV. Opferbringer |
10. (teilweise unterer Durchgang) Nebet und 4
Register von weiblichen Ständen (?) und Opferbringern
Passage III.
11.
(teilweise unterer Durchgang) Vieh hüten und melken
12 + 14. die Verstorbene in 4 Register, Männer in Kanus und
Opferbringer
13 + 15. die Verstorbene in 4 Registern, in denen ihr Tiere gebracht
werden und 3 Registern von weiblichen Begleitern und Opfergaben hinter
ihr.
16. (teilweise unterer Durchgang) Möbel und Bettenmachen
Raum IV.
17 + 18 Fünf Register mit Opferbringern
19. Fünf Statuen-Nischen
Raum V.
20. Ein Mann, der vor und unterhalb (einer zerstörten Szene)
sitzt - zwei erhaltene Register mit Opferbringern
21. unteres Register, Fleischer
Raum VI.
22. Durchgang: Opferbringer
23. Drei Register mit Fleischern und Reste von Opfergaben oben
24 + 25. (letztere meist zerstört), Verstorbene mit Opfertisch und
Opferliste, Priester und Opferbringer
26. Reste einer Scheintür
Raum VII.
27. Durchgang a)+b) Ölkrüge ziehen
28. Ölkrüge
29. Reste von zwei Opferbringers
Hof VIII.
30. Scheintür des Verstorbenen
Funde:
Unterteil einer Statuette mit dem Namen von Unas aus Steatite. |
Eine Besonderheit der
Nebet-Mastaba ist ihre Kapelle (Raum IV) mit einer Länge von 8,40 m (= 16
Ellen) und mit den 4 Kapellen (Statuennischen). Die Existenz einer vierten
Nische von denen eine die Kartusche des Unas aufweist, ist eine bisher
ungeklärte Ausnahme gegenüber den konstanten 3 Kapellen in den
Pyramidentempeln der Königinnen. Evtl. stand in der 4. Nische mit der
Kartusche des Königs eine Königsstatue - während in den anderen drei
Nischen jeweils eine Statue der Königin Nebet stand. Die Scheintür im
Totenopfer-Raum der Nebet bestand aus Kalkstein, deren Bemalung Granit
imitieren sollte. Davor stand ein Altar aus Alabaster.
Im Westen (links) des 1. Vorraumes befindet sich ein
geräumiger, großer Hof - ohne Dekoration.
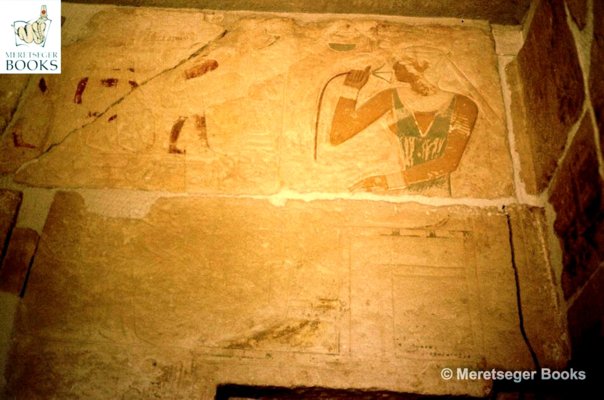 |
Königin Nebet
Die Königin Nebet ist hier thronend
über der Türöffnung abgebildet, welche die ersten beiden Räume in
der Mastaba mit einander verbindet (3). Sie atmet den Duft einer
Lotusblume ein, ihr Diadem ist ein breites Kopfband, am Hinterkopf
gebunden, von dem ein loses Ende lang herunterhängt.
Sie trägt ein fast bis zu den
Knöcheln reichendes, enganliegendes Gewand mit breiten Trägern, welche
die Brüste freilassen. An ihrem Kleid hat sich die originale, grüne
Farbe noch weitgehend erhalten.
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- all rights reserved - |
|
Passage in Raum IV. (PM III, Part 2 - 624
[III. 13-15]
4. Register: Vorlesepriester mit großen Krügen -
darüber Männer in Kanus mit Opferbringern |
|
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- all rights reserved - |
|
Passage III. - ein Schilfboot (PM 12+14)
im Nil darunter ist ein Krokodil und ein Nilbarsch zu sehen |
|
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- all rights reserved - |
Der 720 m lange Aufweg,
der den Taltempel mit dem Totentempel des Pyramidenkomplexes von Unas
verbindet und dabei einen Höhenunterschied von ca. 34 m überwindet, wurde
entlang des Pfades eines natürlichen Wadis gebaut. Dabei wurde ein
Höhenunterschied von ca. 34 m überwunden. Einige der Blöcke, mit
denen die Lücken des Aufweges gefüllt wurden, stammten aus der Umfriedung
des Netjerichets-Komplexes (Djoser). Die Architekten von König Unas
usurpierten etwa 250 m (820 f) des Djoser-Aufweges, um
den Damm von Unas zu stützen und Lücken zwischen ihm und dem Wadi zu
schließen. Der Aufweg von Unas ist der am besten erhaltene aus dem Alten
Reich.
|
Ende des Unas-Aufweges vor den Ruinen des
Totentempels |
Bild: Courtesy to Jon Bodsworth
- public domain - |
Zwar bot das Wadi eine natürliche Route, aber der Bau
des Aufweges war kompliziert und erforderte die Überwindung von unebenem
Gelände und älteren Bauwerken, die abgerissen und deren Steine dann als
Unterlage verwendet wurden. Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen auch Quader aus
der Djoser-Umfassungsmauer zum Vorschein, die für den Bau des Damms verwendet
wurden - deshalb ist davon auszugehen, dass der Djoser-Bezirk damals bereits
im Zerfall begriffen war (Quellen: Mark Lehner 2008, The Complete Pyramid,
New York, Thames & Hudson + Mirosloav Verner, 2020: Die Pyramiden, Reinbek
1997, Die Pyramide des Unas).
Während seines Verlaufs änderte der Aufweg zweimal
seine Richtung, um die natürlichen Gegebenheiten des Geländes möglichst gut
nutzen zu können. Der Damm wurde in zwei Kurven gebaut - nicht in einer
geraden Linie (4). U. a. befinden sich unter dem Aufweg zwei große
Königsgräber aus der II. Dynastie (Toby Wilkinson, 2005, Early Dynastie
Egypt, New York & London, Routledge-Verlag). Das westliche
Galeriegrab enthält Siegel mit dem Namen "Hotepsechemui" und Nebra,
deshalb glaubten die Ägyptologen Wolfgang Helck und Peter Munro, dass
zumindest Nebra im Galeriegrab (B) unter dem Damm der Unas-Pyramide in Saqqara
begraben wurde, weil tatsächlich dort die meisten Artefakte mit Nebras Namen
gefunden wurden (Peter Munro, Der Unas-Friedhof Nordwest I. - v.
Zabern-Verlag, Mainz 1993, S. 95). Auch die
Doppelmastaba des Ni-anch-chnum und Chnum-hotep (Mitte der 5. Dynastie) wurden
abgerissen und deren Material für die Aufschüttung der Unebenheiten des
Geländes verwendet. Die Überbauten der Grabanlagen wurden abgerissen, so
dass der Totentempel und das obere Ende des Aufweges darüber errichtet werden
konnten (Quelle: Aidan Dodson 2016, The Royal tombs of Ancient Egypt, Barnsley
South Yorkshire: Pen & Sword Archaeology. ISBN 978-1-47382-159-0)
Der Aufweg war steingepflastert
(Reste davon wurden in situ gefunden). Die Seiten des Aufweges wiesen
eine steile Böschung auf, welche die obere Breite auf ca. 6,70 m reduzierte.
Auf diesem massiven Unterbau erhob sich der übliche überdeckte Korridor. Die
Seitenwände des Aufweges bestanden aus feinen Kalksteinblöcken und waren lt.
dem Ägyptologen I. E. S. Edwards (1909-1996) ca. 4 m (13 Fuß) hoch und 2,04
m (6 Fuß, 8 Zoll) dick. Der Durchgang war etwa 2,65 m (8 Fuß, 8 Zoll) breit
und besaß ein Dach aus 0,45 m (1 Fuß, 6 Zoll) dicken Alabaster-Platten, die
von jeder Wand zur Mitte ragten und in der Mitte einen Längsspalt von 0,20 m
freiließen, durch den das Tageslicht einfallen konnte. Zugleich verhinderte
diese Konstruktion, dass eindringendes Regenwasser an die reliefgeschmückten
Seitenwände gelangte (4). Die Decke war blau gestrichen
und mit gelben Sternen versehen.
|
der teilweise rekonstruierte Aufweg des Unas -
mittlere Sektion
Rekonstruktion eines Abschnitts in der Mitte des
Aufweges. In der Mitte des Dachs befindet sich eine Öffnung in Form
eines "V", sorgt für Licht in dem Korridor des Aufweges. |
|
Bild. Saqqara
BW8
Autor: Berthold Werner, Wikipedia 3. 11. 2010
Lizenz: CC
BY 3.0 Namensnennung |
|
Blick auf das Ende des zweiten Abschnitts des
Aufweges - Im Hintergrund die Königspyramide
Im Hintergrund ist zu sehen, dass der Aufweg dort
einen Knick nach links macht - links davon sind die beiden Bootsgruben
zu erkennen. |
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12. Jan. 2007)
- all rights reserved - |
Nur wenige der untersten Steinlagen der Seitenwände fanden sich noch in
situ, doch wurden viele davon verstürzt im Sand längst des gesamten
Aufwegs gefunden. Die Innenwände des Aufweges waren reich in feinster
Reliefarbeit verziert, die bei Sahure und Niuserre den Darstellungen der
königlichen Macht und Abwehr der feindlichen Umwelt vorbehalten und durch
Szenen erweitert wurden, die nur teilweise in dieses Bildschema passen.
Zwar sind die Aufzeichnungen
darüber bruchstückhaft, doch zeigen die Überreste eine Vielzahl von Szenen,
darunter:
-
die Jagd auf wilde
Tiere
-
das Einbringen der
Ernte
-
Szenen auf dem Markt
-
Handwerker bei der
Kupfer- und Goldverarbeitung
-
eine Flotte bei ihrer
Rückkehr aus Byblos
-
Boote, die
Arbeiterkolonnen von Assuan zur Baustelle transportierten
-
Schlachten mit Feinden
und Nomadenstämmen
-
den Transport von
Gefangenen
-
Reihen von
Opferbringern
-
und eine Prozession der
Abgesandten aus den Gauen Ägyptens.
| Bildprogramm an
den Wänden des Aufwegs: |
Schiffsszenen
(Lastschiffe)
Z. B. zeigen die Darstellungen an den Wänden den
Transport fertiger Palmstamm-Säulen aus rosafarbigem Granit und Architrave
aus den Steinbrüchen von Assuan, die auf Schlitten festgebunden sind, welche sich auf Transportschiffen befinden und zur Pyramidenbaustelle gebracht
werden. Die Säulen sind paarweise auf den Schiffen verladen. Lt.
Begleitinschrift hat der Transport dieser Bauteile auf Lastschiffen zum
Bauplatz in Saqqara "nur 7 Tage gedauert - "beladen mit
Granitsäulen von 20 Ellen (=10,48 m).
|
Rekonstruierte Darstellung auf dem Mittleren
Abschnitt des Unas-Aufweges (in situ) in Saqqara
Frachtschiffe transportieren schwere Granitsäulen
vom Steinbruch in Assuan zur Pyramidenanlage von König Unas in Saqqara.
Die Darstellung auf dem originalen Steinblock in Saqqara ist heute
schwer beschädigt. |
|
Zeichnung: Universität of Chicago Oriental Institute
Publ. XXXC Bd. II. Chicago, 1936, Tafel 88 |
|
Frachtschiffe transportieren schwere Granitsäulen
vom Steinbruch in Assuan zur Pyramidenanlage von König Unas in Saqqara.
Die Darstellung auf dem originalen Steinblock in Saqqara ist heute
schwer beschädigt. |
|
Bild: Neithsabes, Wikipedia - public domain |
Hochseeschiffe
Andere Szenen zeigen zwei Hochseeschiffe mit
bärtigen Asiaten (es handelt sich wohl nicht um Kriegsgefangene) an Bord,
welche dem König huldigen.
|
Aufweg der Unas-Pyramide
Zwei Schiffe mit Asiaten, wahrscheinlich Syrer oder
Phöniziern, die unter dem Kommando von ägyptischen Offizieren nach
Ägypten fahren. |
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Aufweg der Unas-Pyramide - das zweite Schiff /
Mittlerer Abschnitt
Teilrelief des 2. Schiffes mit Asiaten. Fünf Leute
am Bug, darunter ein Ägypter und eine anscheinend wichtige Frau mit
erhobenen Armen (zweie von rechts), hinter der eine Gruppe von Asiaten stehen. Am hinteren
Ende des Schiffes ist noch mal eine Gruppe Asiaten zu erkennen, die
ebenfalls ihre Arme erhoben haben. |
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007
- alle Rechte vorbehalten - |
Marktszenen
Es fanden sich auch Darstellungen an den Wänden des Aufweges mit
sehr lebendig wirkenden Marktszenen. An den Wänden
des Aufwegs finden sich auch sehr lebendig wirkende Marktszenen; in einer
sieht man Männer Fische feilbieten; rechts versucht ein Käufer einen Kuchen
gegen Frischfisch einzutauschen. In einer erweiternden Fortsetzung dieser Szene sieht man einen jungen Mann
der Händlern und Kunden sein Schoßtier, einen Affen/Pavian zeigt, während
ein Möbelstück für einen Korb voller Fische seinen Besitzer wechselt. Der
Fischhändler streckt dabei seine Hand mit einer außergewöhnlicher
ausdrucksstarker Gebärde aus.
|
Aufweg der Unas-Pyramide - mit Marktszene /
Mittlerer Abschnitt des Aufweges
Marktszene: Junge Männer mit gefangenen Pavianen
links und ein Zimmermann mit einem Korb rechts. Der Block stammt
aus dem unteren Teil einer der dekorierten Wände des Aufweges. |
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt
des Aufweges - mit Marktszene
Marktszene: Fischer sitzen auf dem Boden - neben sich
ihre Körbe mit Fisch. Sie scheinen gerade ihre Ware zu verkaufen. der
linke Verkäufer sitz auf einem niedrigen Stuhl (ohne Beine) und
präsentiert seine bereits ausgenommenen Fische. Auffallend ist die
ungewöhnliche Art, wie er seine Beine übereinander schlägt. |
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007
- alle Rechte vorbehalten - |
Handwerkerszenen
Die
Darstellungen zeigen auch Handwerker bei ihrer
Tätigkeit: Goldschmiede beim Hämmern von Edelmetallfolien, während andere
bei der Herstellung von Elektron Blasrohre benutzen, um das Feuer unter dem
Schmelztiegel stärker anzufachen. Andere Handwerker werden beim Kupferguss
und beim Polieren von
Gold- und Steingefäßen dargestellt.
Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt
des Aufweges - Handwerkerszenen
Mittlerer Abschnitt des Aufweges mit einem
Block aus dem unteren Teil der Wände. Szenen aus einer Werkstatt von
Gold- und Silberschmieden und anderen Metallarbeiten - hier wird das
"Ausschmelzen von Gold" gezeigt.
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007
- alle Rechte vorbehalten - |
Soldaten
und Kriegsszenen:
Ein anderer Block zeigt einen
Kampf zwischen ägyptischen und ausländischen Bogenschützen, ein weiterer
die Füße von laufende Soldaten.
Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt
des Aufweges - Laufende Soldaten
Kampfdarstellungen ägyptischer Soldaten mit
ausländischen Gegnern
|
|
Bildautor: unbekannt
|
Jagdszenen
Jagdszenen
zeigen allerlei Arten von gehörnten Tieren sowie Füchse, Hyänen,
Springmäuse und Igel. In einer dieser Darstellungen tauchen zwischen
Sanddünen, in denen kaktusähnliche Gewächse gedeihen, zwei Böcke auf, die
einer Oryxs-Antilope zugewandt sind, die ihr Junges leckt. Hinter ihr beißt
ein großer Jagdhund einer Gazelle in den rechten Hinterlauf. Dahinter
erblickt man zwei weibliche Tiere an der Spitze einer Antilopenherde.
Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt
des Aufweges - Jagdszene
In einer Landschaft mit Sanddünen und kaktusartigen
Gewächsen ist hier eine Herde Antilopen zu sehen. Ein großer Jagdhund
hat sich in den rechten Hinterlauf einer Gazelle verbissen. Dahinter
sind zwei weibliche Tiere an der Spitze der Antilopenherde zu sehen.
|
Bild: Neithsabes Wikipedia
14. Juni 2011 - public domain |
Weiter
Darstellungen
Ein
anderer Block vom Aufweg König Unas zeigt Männer in gebeugter Haltung,
welche mit Stöcken den Boden berühren. Diese etwas merkwürdige Szene
konnten wir uns erst nicht recht erklären. Nach Aussage vom Ägyptologen
Prof. Dr. Hartwig Altenmüller (Universität Hamburg) handelt es sich hierbei
wahrscheinlich um die ´"Wegbereitung des Königs durch seine
Höflinge". Dieses "Schlagen mit Stöcken auf den Boden" dient
dazu, gefährliche Tiere wie Schlangen usw. zu vertreiben und so den Weg für
den König sicherer zu machen.
Relief vom Aufweg der Unas-Pyramide
mit der Darstellung einer Prozession "Schlagen mit Stöcken
auf dem Boden"
durch Beamte des Königs.
|
Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro
- all rights reserved - |
Weitere
Szenen zeigen den König im Kreis von Gottheiten; bei einer Inspektion seiner
Truppen und Offiziere; bei der Entgegennahme von Opfergaben; der Transport von
Gefangenen; Darstellungen von Höflingen und Dienern, die Vorräte aller
Art zum Grab bringen; Entgegennahme des Tributs aus fernen Ländern mit wilden
Tieren, darunter eine Giraffe (was die erste Darstellung einer solchen war im
Alten Reich) Löwen und Leoparden. Gezeigt werden auch Szenen aus der
Feldarbeit, der Ernte von Früchten und Feigen, Einbringen des Korns und des
Sammelns von Honig.
Die
berühmten Hungersnot
Darstellungen
Besondere
Beachtung findet die zeichnerisch hervorragend gemachte, aber beängstigend
naturalistische Szene von "ausgehungerten Wüstennomaden, die sich in
einem "hoffnungslosen Zustand" befanden und deren Körper so
ausgemergelt waren, dass sie fast nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Der
Ägyptologe Miroslav Verner hebt diese Szenen besonders hervor und meint,
"dass die Nomaden möglicherweise hier so dargestellt wurden, um als
"einzigartiger Beweis" dafür zu dienen, dass der Lebensstandard der
Wüstenbewohner, während der Herrschaft von König Unas infolge klimatischer
Veränderungen in der Mitte des 3. Jahrtausend v. Chr. gesunken war
(Verner 2001d - The Pyramids: The
Archaeology and History of Egypt's Monuments. Cairo: American University in
Cairo ISBN 978-0-8021-1703-8).
Die
Entdeckung einer ähnlichen Reliefmalerei auf den Blöcken des Sahure-Aufweges
lässt allerdings Zweifel an dieser Hypothese aufkommen. Der französische
Ägyptologe Nicolas Grimal (geb. 13. Nov. 1948 in Libourne, Gironde)
vermutete, dass diese Szene die landesweite Hungersnot vorwegnahm, welche
Ägypten zu Beginn der 1. Zwischenzeit heimgesucht zu haben scheint. Diese
Meinung galt allgemein bis vor kurzem für die Verschlechterung der
Lebensbedingungen der Oasenbewohner in der ägyptischen Wüste. Vor wenigen
Jahren wurde jedoch - aufgrund der künstlerisch wertvolleren und älteren
Szenen auf Blöcken des Sahure-Aufweges - die Bedeutung dieser Szenen der
"verelenden Beduinen" anders eingeschätzt: wahrscheinlich sollten
sie den Wohlstand Ägyptens gegenüber den Ausländern zeigen oder die
Großzügigkeit des Herrschers bei der Unterstützung der hungernden
Wüstenbewohner darstellen (Quelle: engl. Wikipedia - James Allen Ägyptische
Kunst im Zeitalter der Pyramiden, New York 1999, S. 360).
Beamtengräber südlich des Aufweges
Grabinschriften
aus Gräbern nahe des Aufwegs legen dar, dass der Totentempel des Königs am
Ende des Alten Reiches noch voll in Betrieb war. Auch im Mittleren Reich
bestand der Totenkult des Unas fort. Funde aus dem Taltempel bezeugen einen Kultbetrieb während
des Mittleren Reiches.
An der Südseite der Pyramidenumfassungsmauer kamen kürzlich Schächte
aus der Saiten- und Perserzeit zum
Vorschein, die teilweise von Räubern verschont geblieben waren:
Es handelt sich
dabei um die Gräber des königlichen Leibarztes
Psametich und seiner Gemahlin Setraibu, des
Admirals Djeuhebu, dessen Mumie reichlich mit Juwelen und Amuletten
geschmückt war, und des Pede-ese. Pede-ese/ise
war der Sohn des Leibarztes Psametich und war im Nachbargrab zu diesem bestattet, Pede-ese
lebte zur Zeit Dareios I. (Ende 6. und Anfang 5. Jahrhundert.). Im nordwestlichen
Teil des Totentempels hatte man während der Saitenzeit einen 20m tiefen
Schacht in den Boden getrieben, auf dessen Grund sich das Grab des Generals Amen-Tefnacht befand.
Nördlich des Aufweges wurde eine Ansammlung von
Gräbern gefunden (siehe eng. Wikipedia: Nigel Strudwick, Davies, W. V. (ed.).
The Administration of Egypt in the Old Kingdom: The Highest Titles and Their
Holders, London: KPI Limited). Das Grab des Wesirs "Achethep" wurde
von einem Team unter Leitung von Christiane Ziegler entdeckt. Die anderen
Mastabas gehören den Wesiren Ihy, Iy-nofert, Ny-anch-ba und Mehu (Strudwick
1985). Es wird vermutet, dass die Wesire unter der Regierung von Unas
amtierten, mit Ausnahme des Grabes von Mehu, welches der Zeit von Pepi I.
zugeordnet wird. Ein weiteres Grab, das Unas-Anch (wahrscheinlich ein früh
verstorbener Sohn von Unas) gehörte, trennt die Gräber des Ihy und Iy-nofert.
Der Chefinspektor von Saqqara, Mounir Basta, entdeckte
1964 gleich südlich des Damms ein weiteres in den Felsen gehauenes Grab, das
später unter Ahmed Moussa ausgegraben wurde. Die Gräber gehörten zwei
Palastbeamten - Maniküristen (Strudwick 1985) - die während der Regierung
von Niuserre- Ini und Menkauhor in der 5. Dynastie lebten, namens
Ni-anch-Chnum und Chnum-hotep. Im folgenden Jahr wurde eine reich verzierte
Kapelle für das Grab entdeckt. Die Kapelle befand sich in einer einzigartigen
steinernen Mastaba, die durch einen schmucklosen offenen Hof mit den Gräbern
verbunden war (Quelle: engl.
Wikipedia - James Allen Ägyptische Kunst im Zeitalter der Pyramiden, New York
1999, S. 162).
Der Oberste Rat für Altertümer
führte von 1999 bis 2001 ein großes Restaurierungs- und
Rekonstruktionsprojekt am Taltempel durch. Die drei Eingänge und Rampen
wurden restauriert und eine niedrige Kalksteinmauer errichtet, um den
Grundriss des Tempels abzugrenzen. Bei den ersten Grabungen, die 1945 von
Selim Hussein im Auftrag von Etienne Driton durchgeführt wurden, sind die
Umrisse des Taltempels und eines großen Bassins festgestellt, welches sich
als eine Hafenanlage am Westufer eines heute nicht mehr existenten Sees (der
auch als Unas-See bezeichnet wird) herausstellte. Außerdem wurden die Reste
dreier Verbindungsrampen gefunden, welche den drei Tempelzugängen an der
Nord-Ost- und Südseite entsprechen. Der Taltempel liegt zwischen denen von
Nyuserre Ini und Pepi II. Trotz eines komplexen Plans enthielt der Taltempel
von König Unas keine bedeutenden Neuerungen.
|
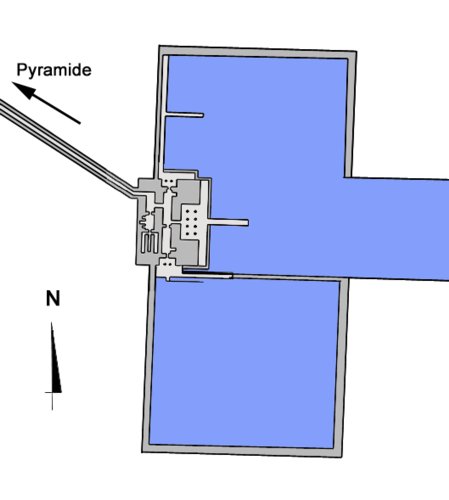
|
Taltempel und Hafenanlage
Der Taltempel von König Unas lag
mitsamt seiner Hafenanlage am Westufer eines heute nicht mehr existenten
Sees, der auch als Unas-See bezeichnet wird. Der Zugang zum Taltempel
erfolgte von der Ostseite und war über eine Treppenanlage erreichbar,
und hatte drei Eingänge mit papyriförmigen Säulen, von denen einige
begradigt wurden. Daran schloss sich ein säulenförmiges Vestibül an -
wahrscheinlich im gleichen Stil, welches den Zugang zu der langen Rampe
ermöglichte, die zum Totentempel der Pyramide führte, der an ihrer
Ostseite lag.
Bild: Franck Monier, Wikipedia 24.
Aug. 2009
- public domain - |
Der Taltempel ist durch
Steinraub heute stark beschädigt, jedoch ist ein Teil der Säulen in
verschiedenen Museen der Welt erhalten geblieben. Der Haupteingang des Tempels
befand sich auf der Ostseite und bestand aus einem Portikus mit 8 in zwei
Reihen angeordneten Granit-Palmensäulen (Audran Labrousse, Ahmed M. Moussa:
Le temple d'accueil du complexe funéraire du roi Ounas, Kairo 1996). Zwei
weitere Eingänge befanden sich im Norden und Süden. Ein schmaler, nach
Westen gerichteter Korridor führte vom Eingang in eine rechteckige, von
Norden nach Süden ausgerichtete Halle. Eine zweite Halle befand sich im
Süden. Zwei Nebeneingänge zu den Hallen befanden sich an der Nord- und
Südseite. Jeder hatte einen Portikus mit zwei Säulen. Diese waren über
schmale Rampen erreichbar. Westlich der beiden Hallen befand sich die
Hauptkulthalle. Sie verfügte über eine zweite Kammer mit drei Lagerräumen
im Süden und einen Gang, der zum Aufweg im Nordwesten führte (Zahi Hawass
2015 "Magic of the Pyramids: My adventures in Archeology, Montevarchi,
Italy: Harmakis Edizioni. ISBN 978-88-98301-33-1)
|
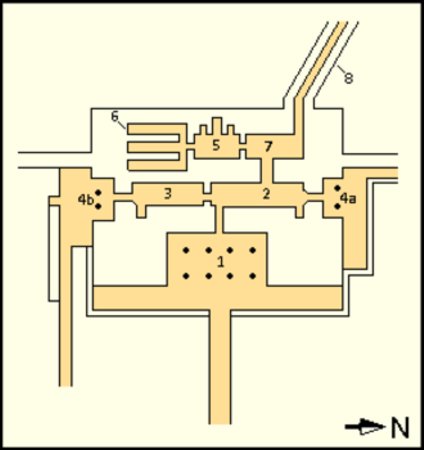
|
Plan des Taltempels
1. Eingangshof mit Säulengang
2. Eingangshalle
3. Südhalle
4a u. b. Nebeneingänge
5. Hauptkulthalle
6. Lagerräume
7. Durchgang, der zum Aufgang (8.) führt.
Basierend auf Mark Lehner (2008): The
Complete Pyramids, New York, Thames & Hudson, S. 154-155
Plan: Herr mddude, eng. Wikipedia, Originalbild,
Lizenz: CC
BY-SA-4.0 |
Von der einst
reichhaltigen Dekoration des Taltempels sind nur wenige Fragmente erhalten.
Die Motive der Szenen waren Gottheiten, Opfergabenträger und Schiffe (Audran
Labrousse, Ahmed M. Moussa: Le temple d'accueil du complexe funéraire du roi
Ounas, Kairo 1996).
Ein Raum des Taltempels wurde am
Ende des Alten Reiches als Bestattungsplatz für einen Prinzen benutzt. Hier
fand man den Sarkophag des Prinzen Ptahschepses, der noch reichen Schmuck
sowie die Mumie eines älteren Mannes enthielt (siehe Dr. Aidan M. Dodson: On
the Burial of Prince Ptahshepses. In: Göttinger Misazellen Nr. 129, 1992, S.
49-51). Bisher konnte aber weder die Identität des Prinzen noch der Grund
für die Bestattung hier im Taltempel des Unas hinreichend geklärt werden.
Guy Brunten (ein engl. Ägyptologe, der für Flinders Petrie grub und auch
mehrere Jahre in Oberägypten, in Qau, el-Badari - wo er die Badari-Kultur
entdeckte - und ab 1931 als "Assistant Keeper" im Ägyptischen
Museum von Kairo tätig war bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1948) hielt ihn
für einen Sohn des Unas, dessen Grab nach der Beisetzung geplündert wurde
und dessen Leichnam in den Taltempel seines Vaters umgebettet wurde (siehe M.
Verner: die Pyramiden, Reinbek 1997, S.369ff). Der britische Ägyptologe Dr.
Aidan Dodson (Universität Bristol) hält Ptahschepses hingegen für einen
Sohn Pepi II., der sich einen Sarkophag aus dem Grab der 4. Dynastie aneignete
und für seine eigene Bestattung verwendet habe (siehe Dr. Aidan Dodson: On
the Burial of Prince Ptahshepses: in Göttinger Miszellen 129, 1992, S.
49-51).
|
Ruinen des Taltempels von König Unas |
| Der Taltempel des Unas liegt in einem heute nicht
mehr vorhandenen See, der sich natürlicherweise an der Mündung eines
Wadis in den See bildete. Dasselbe Wadi diente als Weg für den
Aufweg. Der Zugang zum Taltempel erfolgte von der Ostseite über die
Kaianlagen des Hafens - links im Bild mit den zwei Säulen. |
Bild: Taltempel
der Unas-Pyramide in Saqqara
Autor: Olaf Tausch, Wikipedia, 8. 10. 2014
Lizenz: CC
BY 3.0 |
|
Ruinen des Taltempels von König Unas |
| Gesehen vom Anlegesteg aus nach Westen - links die
beiden palmenförmigen Granitsäulen, welche den südlichen Eingang
flankierten. |
Bild: Courtesy to Juan Rodriguez Lazaro - 25. 9.
1991
- all rights reserved - |
Gebiet nördlich des
Pyramidenbezirks von Unas
- Die Gräber der königlichen Familie - |
Zwischen dem südlichen Teil der
Umfassungsmauer des Djoserbezirks und dem Pyramidenkomplex des Unas verlief
ein tiefer, künstlich hergestellter Graben (der sog. Trockene-Graben), der
aus der Zeit von König Djoser (3. Dynastie) stammt. Während der Bauarbeiten
am Pyramidenkomplex von König Unas wurde dieser Graben mit dem anfallenden
Abraumschutt beim Pyramidenbau teilweise wieder aufgefüllt und als
Standfläche für die Errichtung der Mastabas genutzt.
|
Nördlichste der Mastaba-Reihen mit Grab der
Seshseshet-Idut |
Plan: aus Juan R. Lazaro - Flickr-Album
- Originaldaten: Porter & Moss, Topographische Bibliographie
altägyptischer Hieroglyphentexyte, Reliefs und Bilder III. - Teil 2
(1978). S. 623-625, Tafel LXI
- modifiziert von Nefershapiland - |
Die nördlichste
dieser Mastaba-Reihen umfasst von West nach Ost die Anlagen des "Unas-Chai-shetef"-
dann im Verband gebaut die Mastaba-Anlage des "Iy-neferet, des Unas-Anch
des Obersten Richters und Wesir "Ihi", die später von der
Prinzessin Seschseschef-Idut ("das Mädchen"
) einer Tochter von König Unas usurpiert wurde und ihres mutmaßlichen
Sohnes "Mehu", dessen Mastaba direkt an der Mastaba von Idut
angrenzte. Die Mastaba der Prinzessin Sesheshet-Idut wurde 1927 ausgegraben.
Die Titel der Prinzessin lauteten:
|
"Tochter des
Königs, von seinem Laib und nach ihm allein verehrt, die Hathor
täglich verherrlicht, verehrt neben Anubis auf seinem Berg,
Seshseshet mit ihrem erhabenen Namen Idut"
(Quelle:
Macramallah, R.: Le Mastaba d'Idout 1935 (= Fouilles á Saqqarah, Band
15, Leroux Paris - Online-Version) |
Die Mastaba von
Mehu war in einem hervorragenden Erhaltungszustand und man erfährt aus den
Inschriften, dass dieser Mehu ein Wesir in der Anfangszeit der 6. Dynastie
war. Die Aufschüttungen endeten hier und daher lag die Mastaba des Mehu (MHw)
erheblich tiefer.
In der Grabkammer wurde der ursprünglich für den
Wesir Ihi gedachte Sarkophag sowie Reste von Wandbemalung entdeckt. Die
Grabkapelle besteht aus fünf Räume mit Reliefdekor (Quelle: engl. Wikipedia:
Seschseschet Idut)
|
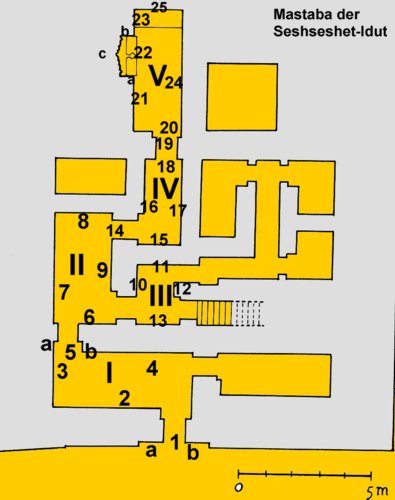
|
Mastaba der Prinzessin
Seshseshet-Idut
Plan nach Lauer "Saqqara" -
modifiziert von Nefershapiland
Raum 1:
1. Eingang (Durchgang) a) und b) Fragmente mit der
Verstorbenen
2. (nur unterer Teil) die Verstorbene im Papyrusboot u. anderes
schmales
Boot mit Männern (einer beim Fischen mit
Dip-Netz, andere beim Angeln)
3. (unteres Register) Schreiber und andere Männer, welche die
Verwalter
der Gutshöfe zur Rechenschaftsablegung
vorführen.
4. (nur unterer Teil) [Verstorbene] in einem Boot und links ein
kleineres
Boot mit Männern beim Fischen mit einem
Dip-Netz und beim Angeln.
5. Durchgang zu Raum II.
a) + b) 2 Register: I. Opferbringer II.
Ziehen und beweihräuchern einer
Statue
Raum II.:
6. Reste von 5 Registern - Männer bringen Rinder
7. mehrere Register: die Prinzessin steht in einem
Binsen-Nachen
I. Reste von Booten II. Hirten beim Viehhüten
III. Papyrusernte und
Bau von Booten IV-IV. Männer mit Tieren und
Vögeln in Booten
VI. Männer in Booten beim harpunieren von
Nilpferden, Fischen mit
dip-Netzen und beim Überqueren eines Kanals
mit Rindern.
Register hinter der Verstorbenen
I.-V. Attendanten, Beamte und Schreiber VI.
Männer in Booten beim
Angeln und Fischen mit dip-Netzen.
8. unteres Register, Schreiber und Männer, welche die Verwalter
der
Gutshöfe zur Rechenschaftsablegung vorführen. |
9. Reste von Registern:
I.-II. Opfergaben III. Männer ziehen einen Schrein mit einem
Sarkophag IV. oben ein Schrein, die Verstorbene
mit einem Vorlesepriester und Männer die vor
ihm ein Boot tragen und "mww"(Muu-Tänzer) hinter ihm V.-VI.
Ruderboote und Männer
die sie schleppen mit zerstörter Inschrift
für den Wesir Ihy VII. Opferbringer
Raum III.
10. Reste vom unteren Register: Männer bringen eine Herde mit
Eseln.
11. Reste von drei Registern: Truhen, Männer bringen Truhen mit Salbe
12. Zwei Männer zimmern eine Truhe
13. Reste von drei Registern: Männer bringen Gazellen, ibisse
und Oryx-Gazellen.
Raum IV.
14. Durchgang von Raum II: zu Raum IV.: Reste von
Opferbringer, die Kälber mit sich führen
15. vier Register: I., III. und IV: Opferbringer II. Männer in Booten
mit Kalb
16. (Fragmente) Die Verstorbene und Register I.-IV. Opfergaben V.-VII.
Opferbringer
17. (fragmentarisch) Die Verstorbene mit zwei Frauen hinter ihr und
Register I, III, V-VI Opferbringer II. Bootsmänner beim Tunier (?)
IV. Männer in Booten
18. Über dem Durchgang - 3 Register mit Opferbringer
Raum V.
19. Durchgang a) + b) Die Verstorbene riecht an Lotusblüten -
eine Frau hinter ihr bei b)
20. Register I.-V. (teilweise oben am Durchgang) Opfergaben VI. ein
Mann bindet Ochsen an VII. Schlachter
21. Die Verstorbene vor einem Tisch und riecht an einem
Salben-Behälter
22. Nische mit Scheintür a)+b) 5 Register mit Kisten und
Opferbringern c) Scheintür
23. Opferliste, mit Priester darüber
24. Verstorbene sitzend und riecht an Lotusblüte und im I.-III.
Register Opfergaben, IV-V. Männer bringen Tiere VI. (unter der
ganzen
Szene), Opferbringer und Schlachter.
25. die Verstorbene sitzt vor einem Tisch und riecht an
Salben-Behälter, mit Begleiter hinter ihr und Opfergaben und
Opferträger vor ihr.
Grabkammer mit gemalter Dekoration, Opfergaben, Kisten mit
Federn oben, Opferlisten an der östlichen Wand (siehe Hassan, Giza,
vi, pls p. 136) Sarkophag des Wesir Ichy, usurpiert von der
Verstorbenen
|
Mastaba der Shesheshet-Idut
- Steuereintreiber bei der Arbeit (Raum I.)
Raum I. Westwand (PM 3) - zwei Steuerbeamte
machen Aufzeichnungen, der rechte Schreiber trägt den Namen Teti-anch,
was daraufhin deutet, dass die Grabdekoration erst unter dem
Nachfolger König Teti, dem 1. Herrscher der 6. Dynastie
entstand.
Von der rechten Seite werden den Steuerbeamten evtl. die
Verwalter von Gutshöfen (?) vorgeführt - wohl zum Zwecke der fälligen
Abgaben. Sie kommen in gebeugter Haltung an und werden von den
Aufsichtsbeamten nicht gerade "sanft" behandelt.
|
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten -
- beschnitten von Nefershapiland - |
|
Mastaba der Shesheshet-Idut mit Eingangsszene
(PM II.2-2, 617 [2] )
- Raum I. - Nordwand -
Vor dem Großen Boot der
Prinzessin (rechts im Bild) befindet sich ein Papyrusboot in dem sich
drei Fischer befinden und ein Mann der das Boot stakt. Zwischen seinen
Beinen befindet sich ein Korb für den Fischfang. Am Bug des Bootes
hockt ein Fischer, der mit einer Angel (mit vier Hacken) fischt. In
seiner rechten Hand hat er einen Schlegel zum Schlag erhoben, mit dem er
die gefangenen Fische betäubt. Hinter ihm stehen zwei weitere Fischer
im Boot, die mit einem Schleppnetz (Dip-Netz) ebenfalls Fische fangen. Das
Netz ist prall gefüllt und wird von ihnen gerade ins Boot gezogen.
|
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Mastaba der Shesheshet-Idut - Durchgang
von Raum I. zu II. (PM II-2-2, 617 [5] )
Drei Männer ziehen einen Schlitten (links), auf dem
die Statue der Prinzessin Idut sich befindet. Der vorderste der Männer
gießt Wasser (oder eine andere Flüssigkeit) aus einem Krug vor die
Kufen des Schlittens, um die Reibung zu verringern. Der Mann direkt vor
der Statue verbrennt Weihrauch vor ihr. |
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Mastaba der Shesheshet-Idut -
Raum II. / Westwand (PM 7)
Eine Herde Rinder überquert den Fluss, in
dem sich Fische befinden. Ein Krokodil lauert auf der rechten Seite.
Ein Mann in einem Boot hält eine ängstliche Kuh fest. Im oberen
Register Männer in Booten beim Vogelfang. |
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Das Grab von Prinzessin Idut
verfügt über eine Serdab-Kammer auf der Nordseite, die vollständig vom Rest
der Grabkapelle isoliert ist. Ihre Grabkammer im Schacht auf der Ostseite des
Grabes enthielt bemalte Verzierungen mit Opferlisten und Opfergaben. Die Prinzessin
usurpierte auch ihren Sarkophag on Ihy, dem ursprünglichen Grabbesitzer.
Die Mastaba von Idut wurde
erstmals 1927 von Cecil Firth entdeckt und seitdem von Jean-Philippe Lauer
untersucht. Das Grab der Prinzessin Idut ist normalerweise für Besucher
geöffnet, kann aber gelegentlich aufgrund laufender archäologischer Arbeiten
geschlossen sein.
wird
fortgeführt
Quellen und Literatur
1. dt.
Wikipedia: Unas-Pyramide
2. Labrousse, Lauer, Leclant: Le temple haut du complexe funéraire
du roi Qunas, Kairo 1977
3. Rainer Stadelmann: die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum
Weltwunder, Mainz 1997
4. Miroslav Verner: die Pyramiden, Reinbek 1997
5. Mark Lehner: Geheimnisse der Pyramiden, Düsseldorf 1997 - die
Unas-Pyramide.
6. engl. Wikipedia: Pyramide of Unas

home |

Sitemap |

Biografie Unas |

Biografie Pepi I. |

Biografie Menkaure |
![]()