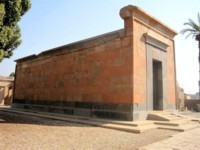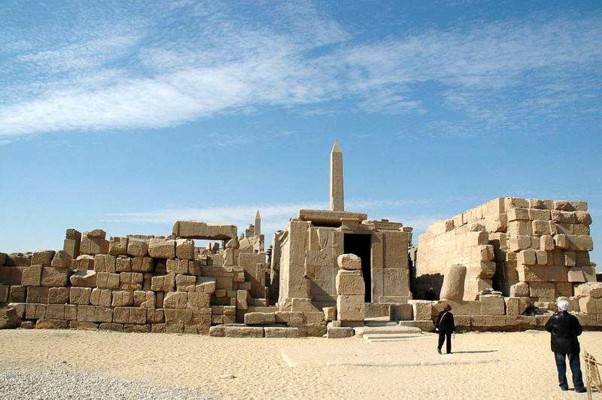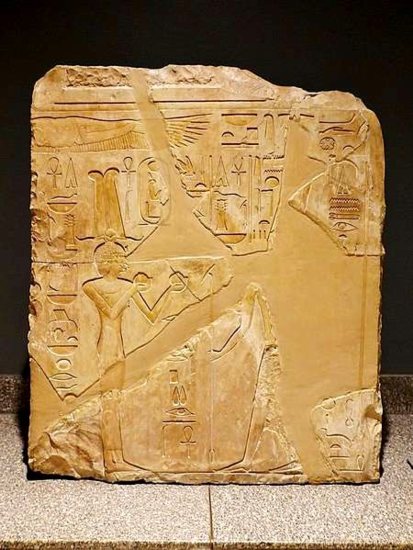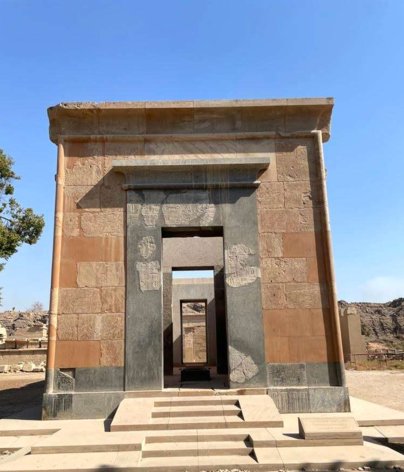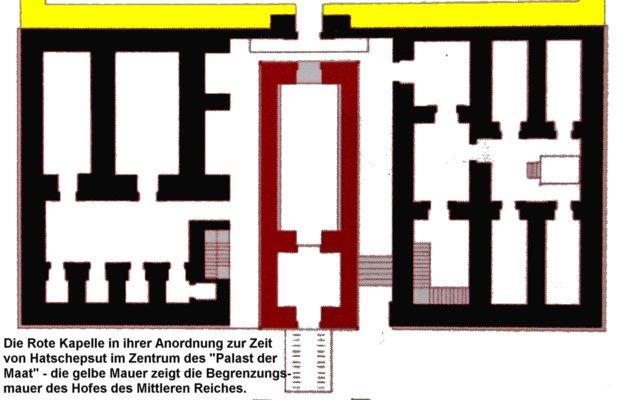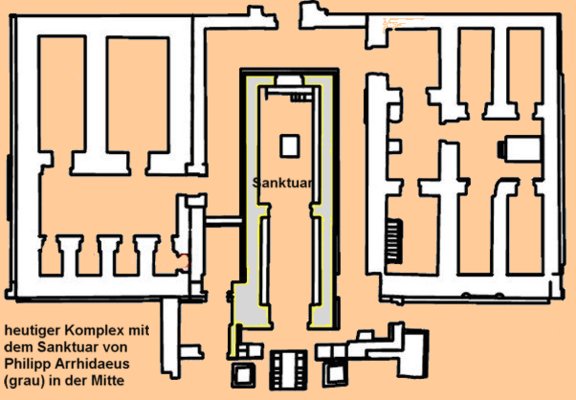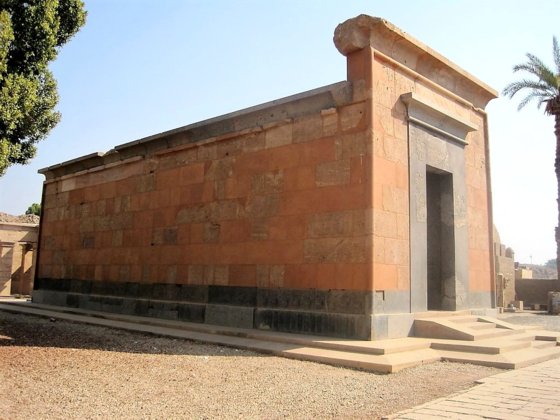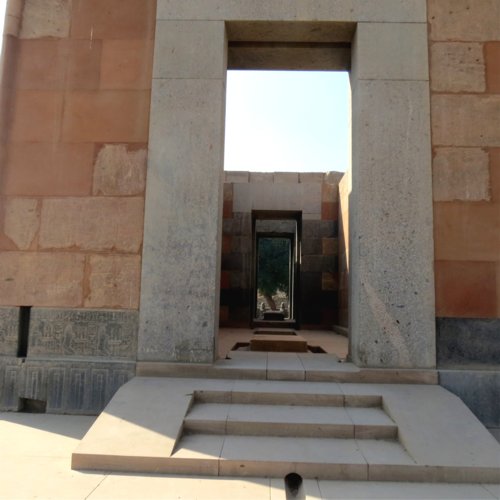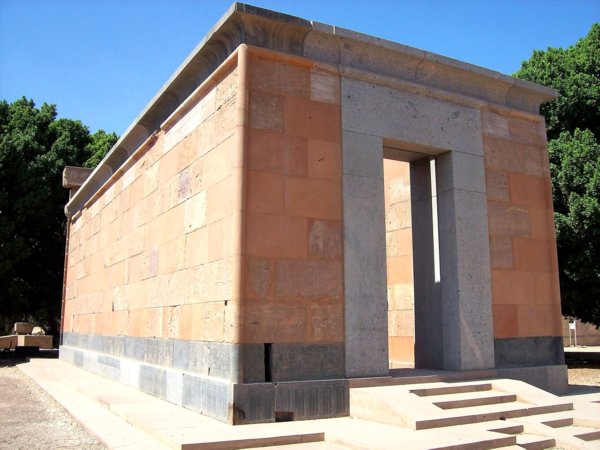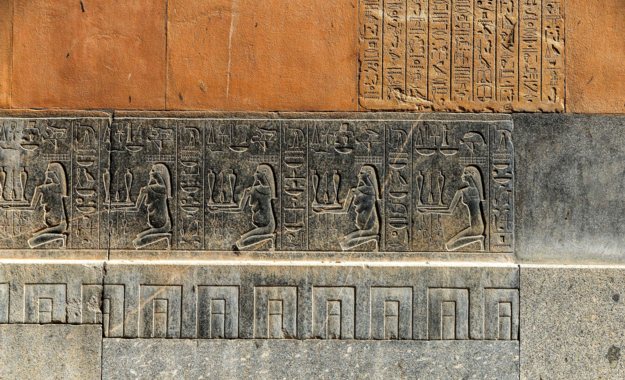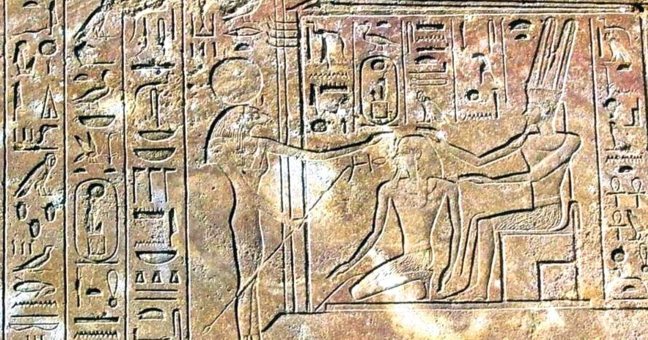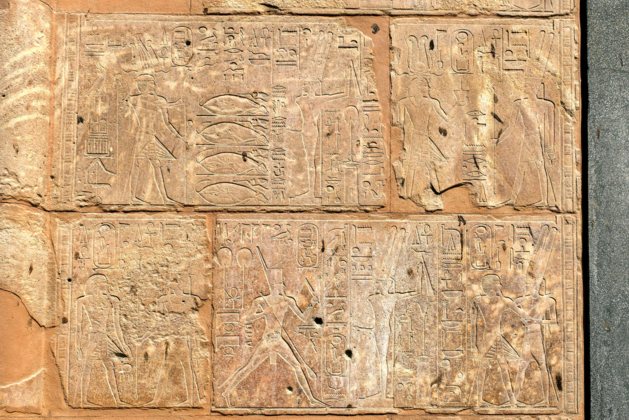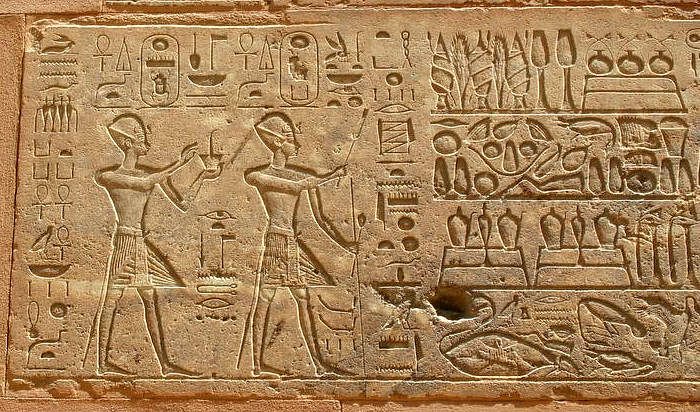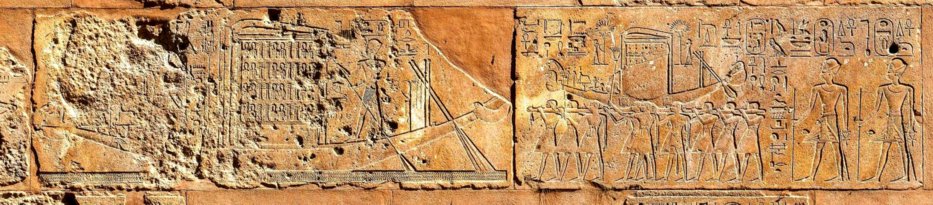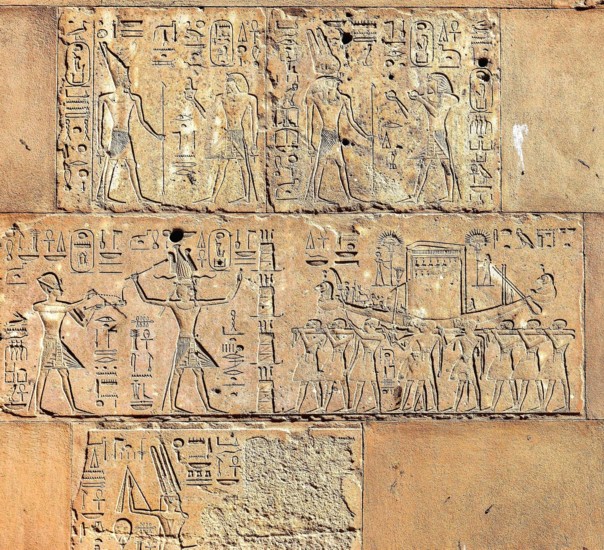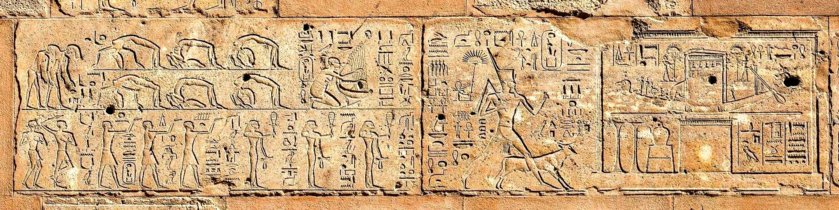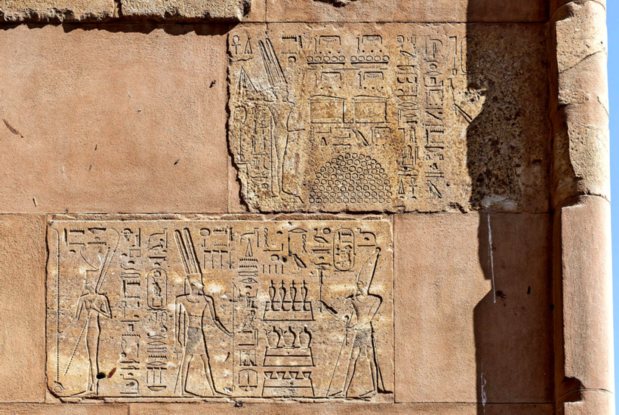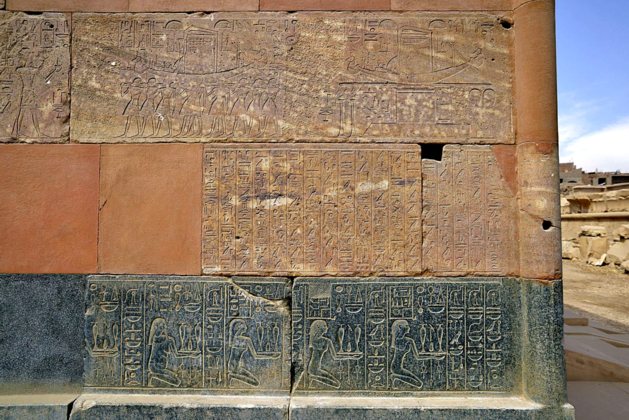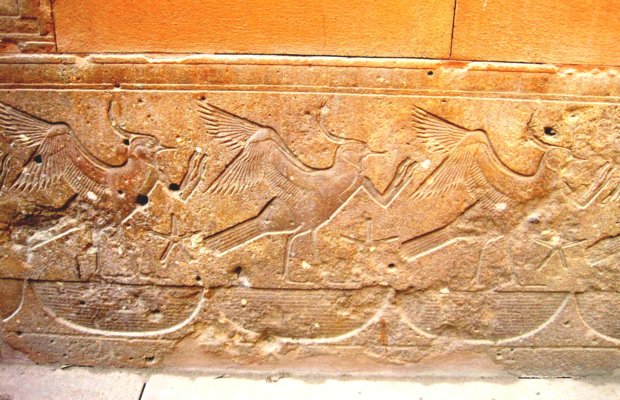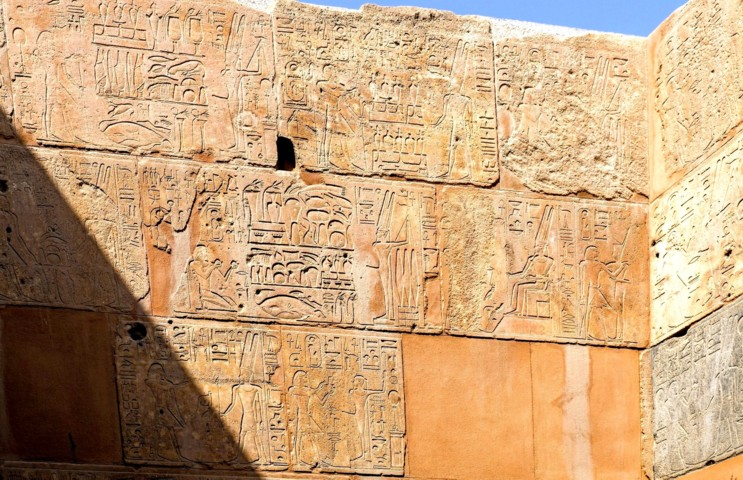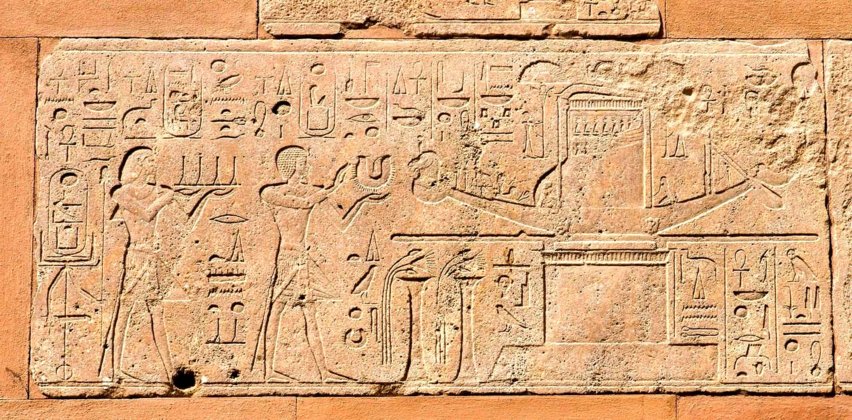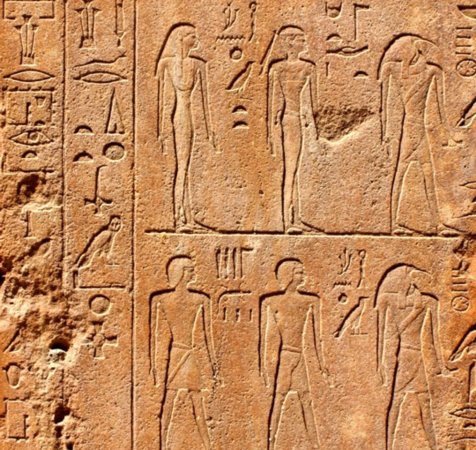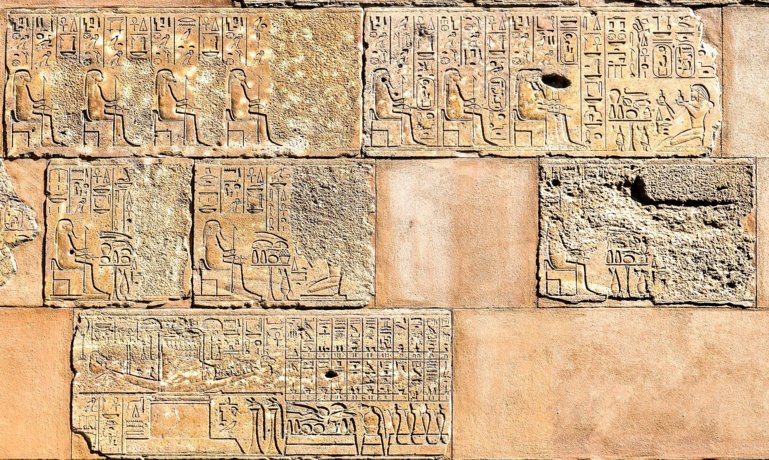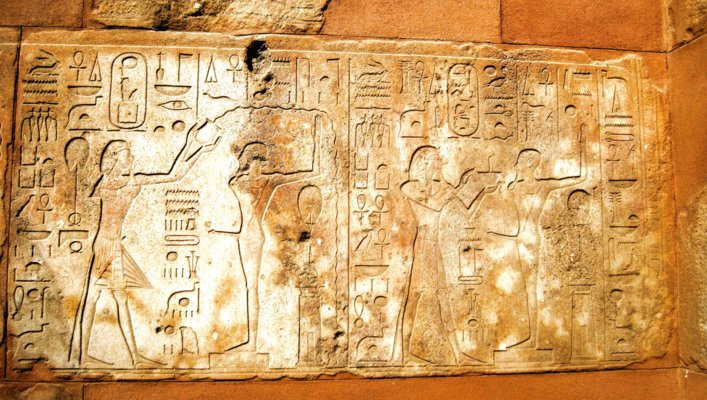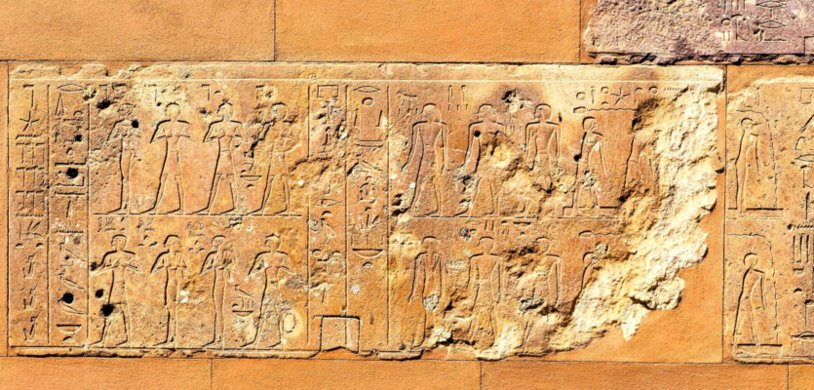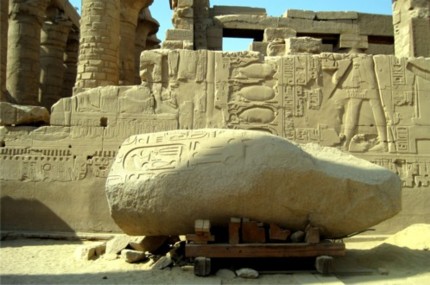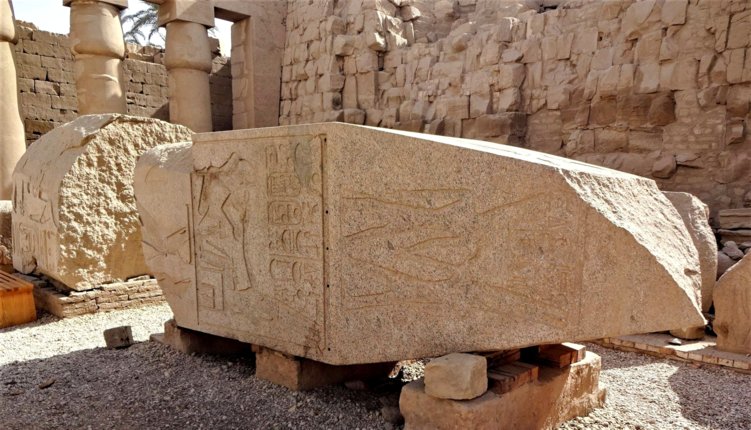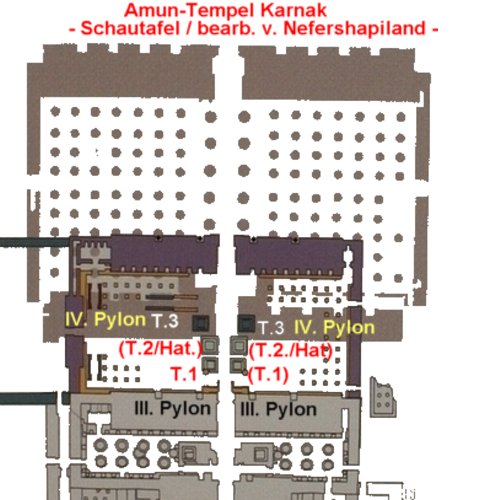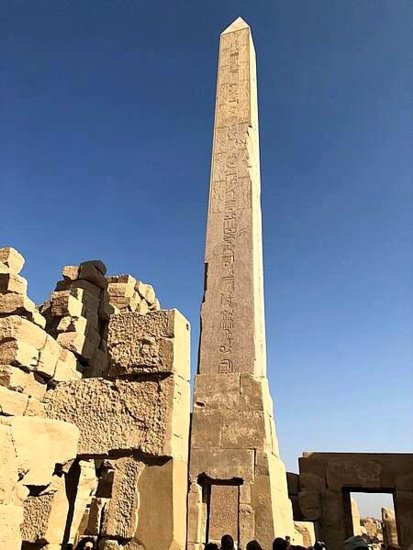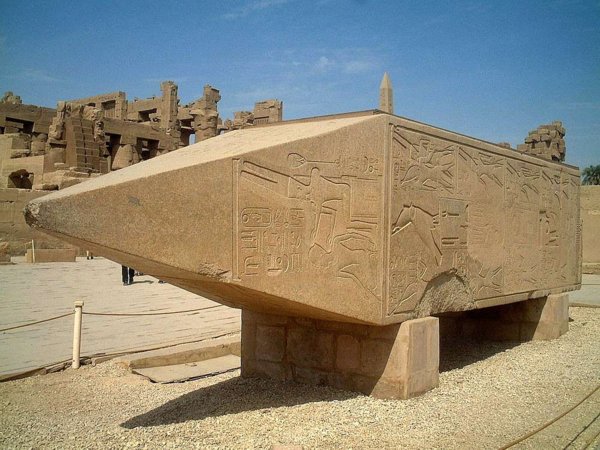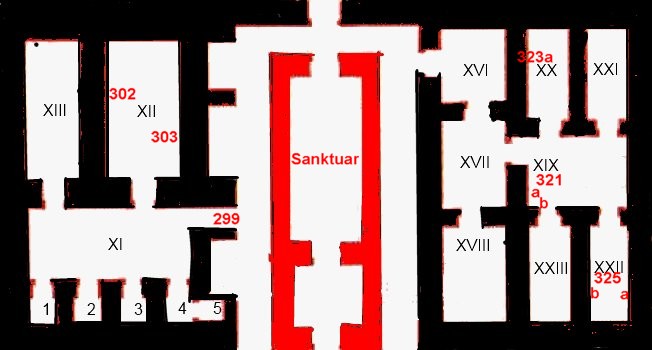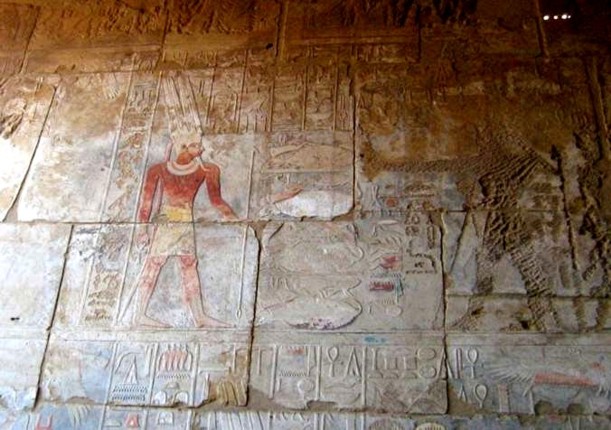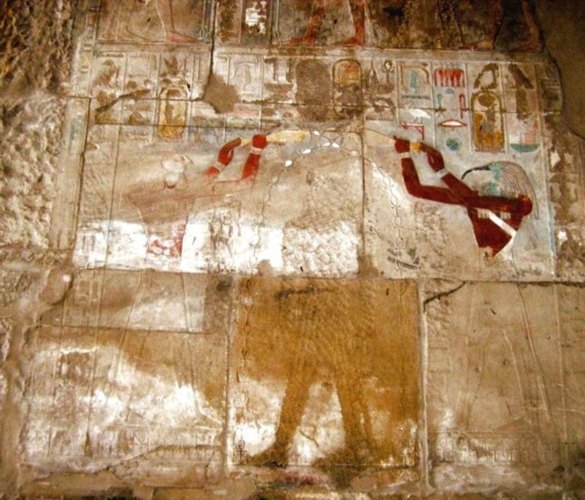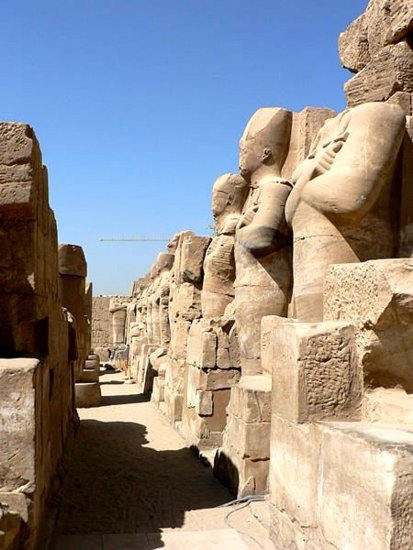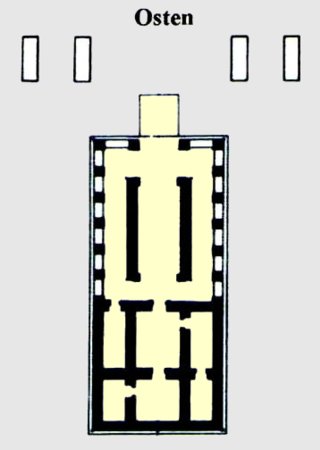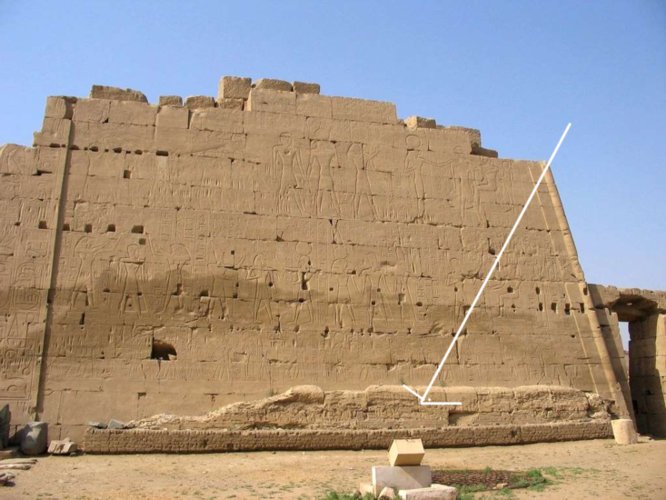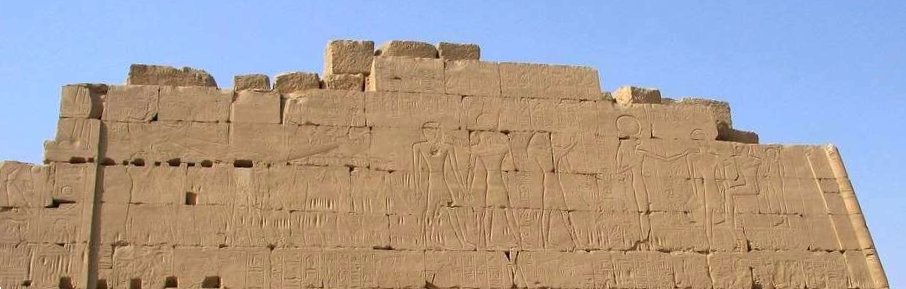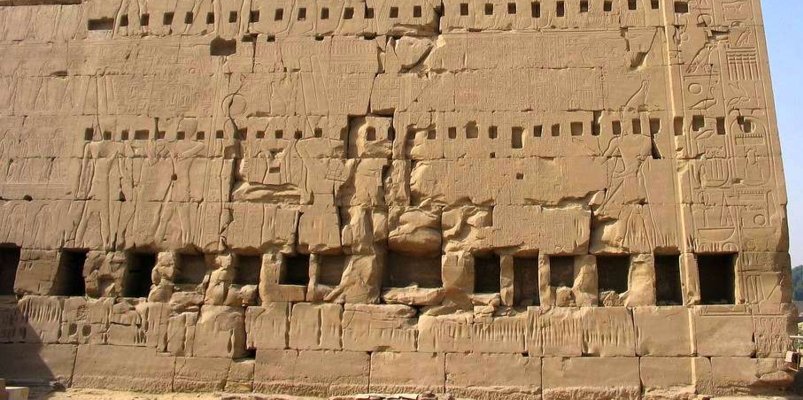Biografie Hatschepsut |

Bauten Hatschepsut allgemein |

Totentempel Deir el Bahari |
Bilder oben: beide Courtesy to Elvira Kronlob -
alle Rechte vorbehalten
Quellen und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite - nummerierte Verweise im
Text
PM = Porter & Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic
Text, Reliefs and paintings 1927 - 1952
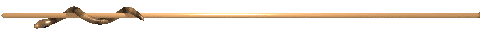
Hatschepsut ließ in ihrer
15jährigen Bauzeit ihren Totentempel in Deir el-Bahari - neben dem Grabtempel
von Mentuhotep (Mittleres Reich) vollenden (vermutlich war Senenmut ihr
Architekt) und ihren Tal-Tempel, der 1908 während der Carnarvon-Carter
Ausgrabungen am Grab Nr. 9 (aus der 17. Dynastie) entdeckt
wurde. Dazu führte sie in ihrer Regierungszeit zahlreiche Bauten im
Amun-Tempel von Karnak durch. Dieses waren neben der Roten Kapelle, einem
Barkenschrein, ihre Obelisken, von denen heute noch einer im Karnak-Tempel
aufrecht steht auch 6 Stationskapellen entlang der Prozessionsstrasse von
Karnak zum Luxortempel (wie sie selber auf der Südwand der Roten Kapelle
berichten ließ).
Und natürlich ließ sie für sich
ihre eigene Grabanlage errichten, wobei sie möglicherweise das Grab ihres
Vaters Thutmosis I. erweiterte und dann für sich selbst benutzte. Den Sarg
ihres Vaters ließ sie neben ihrem aufstellen. Neben diesen Bauvorhaben in
Theben wurde in Theben-West noch ein Tempel des Amun ("Djeser-Set"
oder "Heiliger ist der Ort") im Gebiet von Medinet Habu erweitert
oder vollendet.
Der Schwerpunkt von Hatschepsuts
Bautätigkeit lag natürlich in Theben. Sie muss seit dem Beginn ihrer
Regentschaft bis mindestens zu ihrem 17. Jahr ihrer gemeinsamen Regierung mit
Thutmosis III. fast ununterbrochen Baumaßnahmen am Tempel von Karnak
durchgeführt haben. Leider sind ihre Bauten heute fast alle weitgehend
zerstört oder von Thutmosis III. usurpiert. Manchmal fanden die Ausgräber
nur noch einzelne Blöcke ihrer Bauten mit ihren Kartuschen.
Hatschepsut ließ
zwischen dem Tempel von Karnak und dem von Luxor sechs Barkenschreine für die
Prozession während des Opetfestes errichten.
Die
Prozession vom ersten bis zum sechsten Schrein ist an den Wänden der Roten
Kapelle wiedergeben. Spuren der Wegstationen konnten bisher nur am Tempel der
Mut in Karnak (erste Station) sowie im Dreifachschrein im Luxortempel (sechste
Station) aufgefunden werden.
Unter der Regierung von Hatschepsut wurde der
Karnak-Tempel stark umgestaltet. Das Zentrum des Amun-Re-Tempels in Karnak
erstreckt sich vom 4. Pylon nach Osten bis zum Ach-menu von Thutmosis III.
Weite Bereiche dieses Areals sind heute stark zerstört - jenseits der Großen
Säulenhalle von Sethos I. und Ramses II. ist dieser Bereich nur noch eine
große Ruinenlandschaft. Auch nach der Zeit der Königin Hatschepsut - besonders in der 18. Dynastie und der
19. Dynastie wurde der Tempel mehrfach von Grund auf umgebaut und erweitert.
Sesostris I. (der 2. König der 12. Dynastie im
Mittleren Reich) war der erste große Bauherr im Karnak-Tempel. Von ihm
stammen die Granitschwellen aus Rosengranit, die heute noch auf dem großen
Vorplatz zwischen dem Barkensanktuar und dem Festzelt von Thutmosis III. zu
sehen sind. Sesostris I. ließ auf der Westseite einen Portikus mit je 6
Pfeilern vor jedem Seitenflügel bauen. Eine oside Figur von Sesostris I.
stand vor jedem Pfeiler. Wie der Fund einer großen, steinernen Plattform aus
Sand- und Kalksteinblöcken im
Boden zeigte, überbaute Sesostris I. seinerseits bereits schon eine ältere
Anlage aus den Anfängen des Mittleren Reiches. Luc Gabolde und Czerny (1999)
vermuten, dass diese Plattform zu einem kleineren Tempel des Amun gehört
haben könnte - ähnlich dem "Kleinen Tempel Amun in Medinet
Habu".
|
Der Mittlere Reich Hof - westliche Seite
mit Blick auf Sanktuar und die Kammern der Hatschepsut |
| Im Boden vor dem Eingang
zum Sanktuar sind noch die Reste der Plattform des Mittleren
Reich-Bauwerkes zu erkennen. |
Bild: Tempio
di Karnak
Autor: Francesco Gasparetti from Senigallia, Italy,
Wikipedia 28. 12. 2006
Lizenz:
CC BY 2.0 |
Hatschepsut ließ diesen Portikus abreißen -
nachdem schon Amenophis I. Teile des Mittleren-Reich Tempels abreißen ließ
und sie für seine Bauten im sog. Mittleren-Reich-Hof wiederverwendete - als
sie die Magazinräume und ihre Rote Kapelle - beides wird auch als
"Palast der Maat" bezeichnet - erbauen ließ. Architektonisch ließ
sie aber diese beeindruckende Fassade in ihrem Totentempel wieder auferstehen.
Hier verdoppelte sie die Pfeileranzahl und die osiden Figuren.
Die Bauten von Amenhotep I. standen aber nicht
lange, denn schon Thutmosis III. und Amenhotep III. verwendeten Blöcke aus
den Bauten von Amenhotep I. als Füllmaterial, was bedeutet, dass sie schon in
den Jahren der gemeinsamen Regierung von Hatschepsut/Thutmosis III. abgebaut
worden waren. Während der Ausgrabungen im Karnak-Tempel, fand man zahlreiche
Blöcke, die aus der Zeit von Hatschepsut und Thutmosis III. stammten. Mehrere
Kalkstein-Blöcke aus dieser Zeit wurden im Fundament verbaut bei den
Cachette-Ausgrabungen im Hof vor dem 7. Pylon gefunden. Luc Gabolde hat bei
seinen Untersuchungen der Blöcke im Jahre 2005 vermutet, dass diese Blöcke
mindestens aus 4 aus Kalkstein errichtete Bauwerke in Karnak stammen müssten:
- das "Göttliche Monument" (NTrj
mnw)
- eine kleine
"Nischenkapelle" (für den Kult mehrerer Familienmitglieder der
königlichen Familie
- eine "Barkenkapelle
(Sanktuar ?)"
- und eine weitere kleine
Kapelle
Die "Göttliche-Monument-Kapelle" (siehe
Gabolde), die auf einer Statue des Hapusenb (heute im Louvre A 134) erwähnt
wird, wurde im Open-Air-Museum rekonstruiert und wiederaufgebaut - siehe
 (Bauten Thutmosis III./Hatschepsut). Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute
unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges.
Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und
schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich
wurde sie kurz nach dem Tod von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die
Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil
die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder
Thutmosis II. ersetzt wurde.
(Bauten Thutmosis III./Hatschepsut). Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute
unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges.
Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und
schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich
wurde sie kurz nach dem Tod von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die
Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil
die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder
Thutmosis II. ersetzt wurde.
|

|
Rekonstruktion des "NTrjmnw"
(das Göttliche Monument) im OAM
Hapuseneb überliefert
uns in dem Text auf seiner Statue im Louvre: "....Ich habe
errichtet einen Tempel aus schönen weißen Kalkstein (namens) "Maat-ka-ra,
göttlich durch ihre Monumente") und auf der Roten Kapelle:
"Tempel des Men-cheper-Ra (namens) Amun, Göttlich durch [seine]
Monumente"), das auf die Zeit der Ko-Regentschaft von
Hatschepsut/Thutmosis III. datiert wird.
Allerdings lässt sich
heute der ursprüngliche Standort dieser Kapelle aus weißen
Kalkstein" nicht mehr rekonstruieren - ebenso der genaue Grundriss
(siehe Gabolde 2005). Lt. Gabolde (Hatshepsut at Karnak, p. 37) könnte
es evtl. im Osten des Achmenu gestanden haben.
Bild: Courtesy Elvira
Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
An mehreren Stellen sind die Namen von Thutmosis
II. und der von Thutmosis III. übereinander gesetzt - allerdings nicht der
Name von Thutmosis III. über den seines Vaters Thutmosis II., sondern
umgekehrt: Thutmosis III. wurde durch Thutmosis II. ersetzt. Dieses kann nur
in der Zeit der Hatschepsut erfolgt sein. Auf einem einzigen Block, der im
Achmenu von Thutmosis III. verbaut gefunden wurde, befinden sich Änderungen
des Geburtsnamens der Königin von Hatschepsut in ihren Thronnamen Maat-ka-Ra,
was infolge der Abänderungen auf einen Baubeginn in den ersten Jahren nach
dem Tod von Thutmosis II. und der Thronbesteigung von Thutmosis III. als
Kleinkind schließen lässt.
Höchstwahrscheinlich diente die unregelmäßige,
etwa 12 Meter breite Kapelle als Barkenkapelle. Ein Durchgang mit zwei Kammern
befindet sich auf der linken Seite. Daneben befinden sich an der Vorderseite
die Türen zu zwei Räumen und man gelangte von der Rückseite aus zu einer
Querhalle, die wohl zu drei nebeneinander liegenden Räumen führte.
In den erhaltenen Darstellungen lassen sich 4
Personen identifizieren: Hatschepsut, Thutmosis II., Thutmosis III. und
Neferu-Ra (die Tochter von Hatschepsut und Thutmosis II.), die immer nur in
Begleitung von Thutmosis II. oder Hatschepsut auftaucht - niemals alleine. In
einer der seltenen Szenen sind Thutmosis III. und Hatschepsut gemeinsam
dargestellt - sie stehen jeweils einzeln vor Amun-Re bzw. dem ithypallischen
Amun, d. h. Thutmosis III. und die Gottesgemahlin (und Große königliche
Gemahlin) Hatschepsut sind im gemeinsamen Kultvollzug vor dem Gott zu sehen.
Nischenkapelle
Auf einem Block aus dem Open Air Museum ist
eine Darstellung erhalten geblieben, auf welchem die Gottesgemahlin des Amun (Hmt
nTr) Hatschepsut "Leben" von
Seth erhält und von Nephthys "die Karnak beherrscht" umarmt wird.
Dieser Block ist von beiden Seiten beschriftet - auf der anderen Seite des
Blocks erhält Thutmosis II. (der Vater von Hatschepsut) die Rote Krone
Unterägyptens von Osiris (links) und Isis (rechts von ihm) - auf der anderen
Seite ist die Gottesgemahlin (Hmt nTr) Hatschepsut
zu sehen, die "Leben" von Seth erhält und von der Göttin Nephthys,
"die Karnak beherrscht" umarmt.
|
Block aus dem Open Air-Museum im Karnak-Tempel |
| Block, der beidseitig dekoriert ist - auf der einen
Seite (siehe hier) erhält die Gottesgemahlin Hatschepsut (
(Hmt nTr) "Leben"von
Seth (links unten) und wird von Nephthys (rechts unten) umarmt. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U/Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Block aus dem Open Air-Museum im Karnak-Tempel |
| Thutmosis II. erhält von Osiris (rechts) und der
Göttin Isis (links) die Rote Krone |
|
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob, Engelskirchen
- alle Rechte vorbehalten - |
Auf einem anderen
Block, der ebenfalls zur Nischenkapelle gehört, ist die Prinzessin und
Gottesgemahlin Neferu-Ra (wie die Reste ihrer Kartusche zeigen) zu sehen, die
von der kuhköpfigen Göttin Hathor zu Amun-Re geführt wird. Dieser begrüßt
die Prinzessin. Dieser Block befindet sich lt. Gabolde 2005 im südlichen
Steinlager (siehe Gabolde, 2005).
Diese
Nischenkapelle befindet sich im Südflügel der westlichen Abschlussmauer des
"Großen Festhofes" von Thutmosis II. Die Nischenkapelle hatte 3
Nischen - wobei die 3. der "Tochter des Königs, der
Königsschwester" Neferu-Ra gewidmet war.
Barkensanktuar
Gabolde (2005) rekonstruierte anhand von wenigen
Fragmenten, die man gefunden hatte, den Grundriss eines Barkenschreins (?) -
ein Gebäude mit zwei Räumen (Länge 6 m, Breite 5 m und Höhe ca. 6 m), das
ähnlich wie die Rote Kapelle aufgebaut war. Die wenigen gefundenen Blöcke
zeigen nur die Königin und Thutmosis II. Wahrscheinlich wurde diese
Barkenstation/Barkensanktuar in der Regierungszeit von Thutmosis II. erbaut,
da dieser vor Amun steht und Hatschepsut hinter ihm. In der Zeit nach seinem
Tod (evtl. lt. Gabolde nach dem Jahr 7 der gemeinsamen Regierung von Thutmosis
III. / Hatschepsut ordnete Hatschepsut an, ihre Darstellungen und die
Titulatur ihrer neuen Rolle entsprechend zu modifizieren. Der Fundort der Blöcke und der
ursprüngliche Standort der Kapelle sind unbekannt.
|
Block
aus dem Barkensanktuar der Hatschepsut
- Fundort unbekannt -
heute im Luxor-Museum
Thutmosis II. - hinter ihm Hatschepsut -
präsentiert die beide Stiere und 2 Kälber vor Amun-Re. Thutmosis II. trägt die
Doppelkrone, den Königsschurz und einen Halskragen. In seiner rechten
Hand hält er einen Stock. Hatschepsut steht hinter ihm und hält einen
Fächer und ein Anch-Zeichen in ihren Händen. Das Szepter der
Königsgemahlin wurde in ein "heka"-Zeichen umgewandelt.
Spuren des eng anliegenden Kleides sind schemenhaft noch als Träger
über der linken Schulter zu erkennen.
Über ihren Kopf sind die
Reste ihrer Kartusche zu sehen mit ihrem Thronnamen "Maat-ka-Ra",
der offensichtlich später eingefügt worden ist. Ihre Perücke wurde in
ein "Nemes-Kopftuch" umgearbeitet und ihre Schultern wurden
verbreitert (damit sie maskuliner" wirkt.
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten -
|
weitere kleine Kapelle
Noch weniger erhaltene Blöcke sind
von dem 4. Gebäude aus Kalkstein erhalten geblieben. Labib Habachi hatte von
dieser Kapelle zwei Blöcke publiziert, die aneinander passen und den Rest
eines Szepters von Amun sowie eine Eulogie der Hatschepsut tragen. Gabolde
schreibt in seinem Werk von 2005, dass im Text die Kartusche mit dem Namen
Hatschepsut überarbeitet und durch ihren Thronnamen Maat-ka-Ra ersetzt wurde.
Im Brooklyn Museum, New York (Inv.-Nr. 87.1 = Fragmente eines Gesichts eines
Königs/Königin) und im Ägyptischen Museum Kairo (JE 40640 = Reste der
Titulatur der Maat-ka-Ra und von Thutmosis II. -teilweise zerstört)
befinden sich zwei weitere Blöcke dieses Bauwerkes (1).
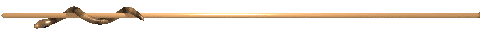
Das Fragment eines Kalksteinblocks wurde 1930 von dem
französischen Ägyptologen H. Chevrier in Karnak gefunden. Es gehört zu
einer abgerissenen Kapelle - möglicherweise von Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Ra),
von der nur sehr wenige Fragmente erhalten sind. Die ursprüngliche Position
der Kapelle im Karnak-Tempel ist unbekannt - ebenso wie sie früher ausgesehen
hatte.
|
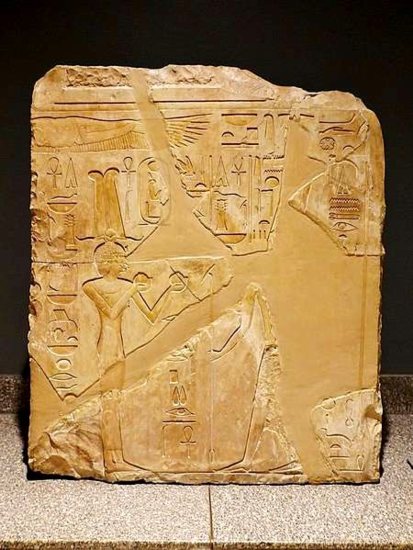
|
Relief aus der Zeit von Hatschepsut
- heute im Luxor-Museum
Die Darstellung zeigt Maatkare - in einem eng
anliegenden Kleid mit der hohen Atefkrone auf dem Kopf - beim
Weinopfer (runde Gefäße) vor Amun. Sie ist hier eindeutig durch die
Beischrift als "König von Ober- u. Unterägypten" und
"Herrin der zwei Länder", "Maat-ka-Ra" als Pharao
zu identifizieren. Die Gabe des Gottes sind "Leben, Dauer, Heil,
Gesundheit und Herzensfreude für die Königin.
Auf diesem Relief sind die entscheidenden Schritte
zur Rolle als Königin und Herrscherin über Ägypten also schon
vollzogen, zu erkennen durch den Herrschertitel: "nesu-bit"
(König von Ober- und Unterägypten und ihren Thronnamen Maat-ka-ra in
einer Kartusche. Die Darstellung der Königin ist hier aber noch typisch
weiblich.
Am oberen Rand wird die Szene durch die
Himmelshieroglyphe abgeschlossen - darunter ein Teil der geflügelten
Sonnenscheibe.
Bild:
LuxorMuseum
Relief Hatschepsut 02
Autor: Olaf Tausch, 17. 10. 2019 Wikipedia
Lizenz: CC
BY 3.0 |
Die sog. "Rote Kapelle" (franz. "Chapelle Rouge")
war ein Barkenschrein für den Gott Amun-Re im Tempel von Karnak. Der
ältägyptische Name des Barkenheiligtums lautete: "s.t-jb-Jmn"
- Lieblingsplatz des Amuns. Die Chapelle
Rouge (Rote Kapelle) war keine unbedeutende Kapelle am Prozessionsweg wie
einige der anderen Kapellen, sondern ihr Platz lag im Zentrum des Amun-Tempels
von Karnak und war "das Haus der Amunbarke" mit ihrem
Götterschrein. Irgendwann am Ende seiner Regierung ließ Thutmosis sie
abreißen.
Heute
befindet sich das Gebäude im Open Air Museum (OAM) des Karnaktempels. Man
erreicht das Gelände, indem man den Großen Festhof (hinter dem 1. Pylon) mit
der Taharqa-Säule zwischen dem I. und II. Pylon nach links gehend verlässt
und den Weg in Richtung der Toiletten folgt. Im OAM befinden sich mehrere
Kapellen:
- die Alabaster-Kapelle von Thutmosis III.,
- die Barkenkapelle "Netjery-menu" (Göttliches Momument -
geweiht für Amun-Re)
- die sog. "Weiße Kapelle von Sesostris I:
- der Alabaster-Schrein von Thutmosis I.
- und ein Kiosk von Thutmosis IV.
- sowie auch die Rote Kapelle der Hatschepsut
|
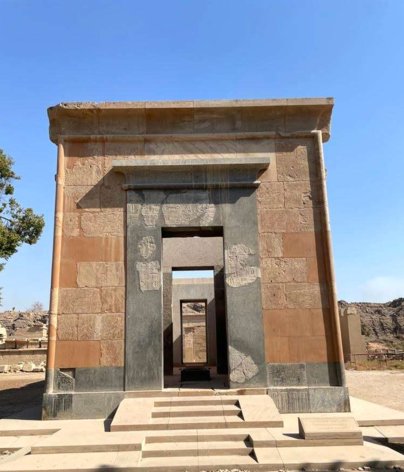
|
Die Rote Kapelle im Open Air Museum von Karnak
- Haupteingang
Zwischen 1898 und 1999 wurden bei
Restaurationsarbeiten im 3. Pylon des Tempels des Amun-Re in Karnak
einige 100 Blöcke, die aus der ursprünglichen Kapelle stammten,
wiedergefunden und vom "Centre franco égyptien d'étude des
tempels de Karnak (CFEETK)" unter der Leitung von Nicolas Grimal
und Francois Larché untersucht und dann zusammen mit weiteren Blöcken
zu einer hypothetischen Rekonstruktion der Roten Kapelle
wiederaufgebaut.
Bei der Roten Kapelle handelt es sich um ein
Barkensanktuar zu Ehren von Amun-Re bzw. seiner ithypallischen
Erscheinungsform des Gottes Amun-Min. Die meisten Blöcke zeigen
Hatschepsut allein oder zusammen mit ihrem Co-Regenten Thutmosis III bei
verschiedenen rituellen Handlungen). Auf den Blöcken befinden sich
Darstellungen des Talfestes, des Opetfestes und des täglichen
Kultbild-Rituals.
Der Haupteingang (Westseite) der Roten Kapelle
überragt mit ihren 7,70 m deutlich die Kapelle selber.
Bild: Courtesy to Carola Schneider
- alle Rechte vorbehalten - |
Der
Bau aus Quarzit- und Dioritblöcken wurde unter Königin Hatschepsut einige
Jahre vor ihrem Tod begonnen und nach ihrem Tod von Thutmosis III. in dessen
Namen vollendet. Später ließ er diese Kapelle wieder abreißen und ersetzte
sie durch einen neuen, eigenen Bau. In der Vergangenheit ist der originale
Standort dieses Heiligtums immer wieder kontrovers diskutiert worden, denn
keiner der gefundenen Steinblöcke wurde in situ gefunden.
Heute
hat sich in aber unter den Ägyptologen die Überzeugung durchgesetzt, dass
sie einst an einer zentraler Stelle im Tempel, vermutlich dort, wo sich heute
das Barkensanktuar des Philipp III. Arrhidaios befindet gestanden hatte. Französische
und ägyptische Archäologen rekonstruierten 1997 das Heiligtum anhand
zahlreicher Originalblöcke im Freilichtmuseum in Karnak. Die Blöcke aus
Quarzit (der aus dem Djebel Akhmar, dem "roten Berg" in der Nähe
von Heiliopolis stammt) verleihen dem Gebäude die rötliche Farbe. Der dunkle
Diorit wirkt gegenüber den Blöcken aus Quarzit wie ein schwarzer Rahmen. Es
wurden von der unter Thutmosis III. abgerissenen Roten Kapelle rund 322 Blöcke
zwischen 1898 und 1990 wieder entdeckt. So entdeckte Georges Legrain erste Blöcke
der "Kapelle" bei seinen Restaurierungsarbeiten im 3. Pylon des
Amun-Re-Tempels von Karnak. Diese Quarzitblöcke waren damals offensichtlich
als "Füllmaterial" für den Pylon wiederverwendet worden. Andere
Blöcke wurden auch auf dem Gelände des Ptah-Tempels und in der Nähe des 9.
Pylons des Amun-Tempels gefunden.
Auf
der Granitbasis der Außenwände sind die Gaue von Ober- und Unterägypten
dargestellt - jeweils durch die Gestalt des Nilgottes "Hapi" mit dem
entsprechenden Emblem für den Gau auf dem Kopf dargestellt.
Aufgrund
ihrer rötlichen Färbung erhielt der Bau von den französischen Archäologen
die Bezeichnung "Chapelle Rouge" (Rote Kapelle) - als Gegenstück
zur "Chapelle Blanche" (Weiße Kapelle) des Sesostris I., die aus
hellem Kalkstein errichtet war. Pierre Lacau und Henri Chevrier veröffentlichte
1977 einen ersten Rekonstruktionsvorschlag (1).
|
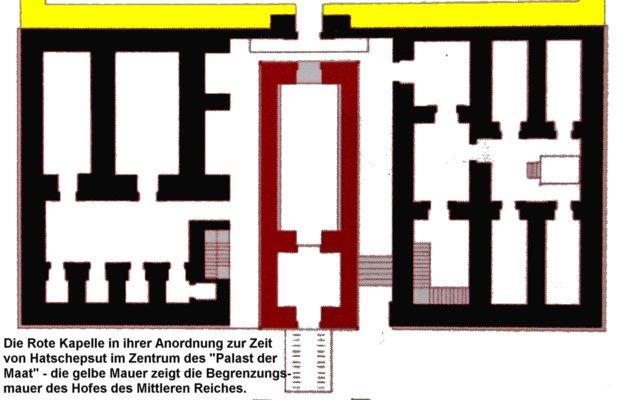
|
Plan Lage der Roten Kapelle
zur Zeit der Hatschepsut
- in Rot dargestellt -
Den Forschungen der französischen CFEET zufolge
befand sich die "Rote Kapelle" "zwischen dem nördlichen
und südlichen Gebäudekomplex des "Palast der Maat".
Zeichnung: nach Larché, La Chapelle Rouge, 2008
- modifiziert von Nefershapiland - |
Allerdings
ist auch heute noch die ursprüngliche Lage der "Roten Kapelle"
umstritten. Einige Forscher gehen weiterhin davon aus, dass sich das Bauwerk
von Hatschepsut ursprünglich "vor" den beiden Gebäudeteilen des
Palast der Maat befand. Hatschepsut ließ um das Allerheiligste im
Karnak-Tempel diverse Um- und Neubauten durchführen, die heute als
"Palast der Maat" bekannt sind. Man fand zwar keinen einzigen Block
der Roten Kapelle mehr in situ
(vor Ort) - aber sicher war sie das zentrale Element dieses Komplexes (siehe
Peter Nadig, m. Clauss: Hatschepsut/Ph. v. Zabern-Verlag, Darmstadt 2014), S.
167). Nach El-Hagazy und Martinez befand sich dieser Komplex nördlich und
südlich des heutigen Barkensanktuars von Philipp Arrhidaeos und die Rote
Kapelle in der Hauptachse vor diesem Gebäudekomplex, wodurch sie vom
Hofbereich umfasst wurde. Die französischen Archäologen vom CFEET vermuten,
dass sie an der gleichen Stelle gestanden hatte, wie das heutige
Barkensanktuar und schlagen vor, dass sie sich an die Westfassaden der
nördlichen und südlichen Hallen anschlossen (siehe Zeichnung oben), was auch
aufgrund ihres Umfanges möglich ist.
Im
Freilichtmuseum (OAM) im Karnak-Tempel wurde die Rote Kapelle im Vergleich zum
ursprünglichen Standort um 90 ° gedreht, aufgebaut. Nun befindet sich ihre
Achse nicht mehr nach Westen, zum Nil hin, sondern zeigt heute südwärts, zum
Luxor-Tempel hin (1).
|
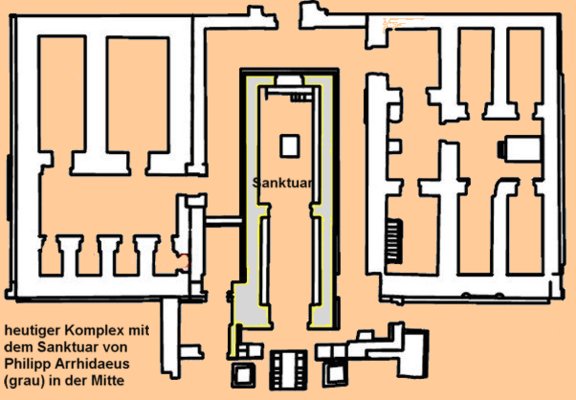
|
Heutigere Zustand des Komplexes
mit dem Sanktuar von Philipp Arrhidaeus
Anstelle des heutigen Sanktuars von Philipp
Arrhidaeus hatte dort zur Zeit der Hatschepsut die Rote Kapelle
befunden, die von dem Gebäudekomplex des "Palast der Maat"
(den Kammern der Hatschepsut) umgeben war.
Zeichnung: nach Larché, La Chapelle Rouge, 2008
- modifiziert von Nefershapiland - |
|
Die
Rote Kapelle - (Nordseite)
Bei
dem Wiederaufbau im "Open Air Museum" wurde die Rote Kapelle
- im Vergleich zum ursprünglichen Standort um ca. 90 Grad gedreht
wiederaufgebaut, d. h. der ursprünglich nach Westen zum Nil hin
ausgerichtete Haupteingang, zeigt heute südwärts zum Luxor-Tempel
hin. |
|
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Bei
der Rekonstruktion der Kapelle zeigte sich, dass fast alle Reliefszenen
jeweils nur über einen Steinblock lang waren - äußerst selten auch
horizontal über zwei Blöcke. Die Steinblöcke, die in
"Ziegelbauweise" verlegt waren, waren einheitlich groß und ähnelten
den Talatat von Echnaton, so dass der Bau relativ einfach war - demzufolge
auch der Abbau unter Thutmosis III. Der Rote Quarzit kam aus den "Roten
Bergen" von Djebel Akhmar - nahe bei Heliopolis).
Man
geht heute nach dem aktuellen Stand der Forschung davon aus, dass Thutmosis
III. die Abschlussreihe der oberen Blöcke setzen ließ und auch mit der
Dekoration an drei Blöcken des 7. und an allen Blöcken des 8. Registers
fortfuhr. Hier tauchte er dann auch nur noch alleine (ohne Hatschepsut) auf.
Einige Jahre nach dem Tod der Königin wurden alle Arbeiten an der Roten
Kapelle eingestellt und sie schließlich abgebaut. Er ersetzte schließlich
die Rote Kapelle durch eine eigene Kapelle aus Granit, welche erst Philipp
III. Arrhidaios Jahrhunderte später erneut umbauen ließ und die noch heute
steht. Nach
der Entfernung der Torpfosten aus Diorit, welche bereits die Namen von
Thutmosis III. trugen, wurden diese für seinen Neubau im Zentrum des
Amun-Re-Tempels wiederverwendet. Das Osttor wurde in der Nordwand des
Korridors des Annalensaals und das westliche Tor des Vestibüls im südlichen
Tor des VI. Pylons ein- und umgebaut (siehe Franck Burgos, Francois Larché:
La chapelle Rouge, Paris 2008, S. 11). Die Namen und Darstellungen der
Hatschepschut wurden ausgemeißelt, wohl erst nach dem Abbau der Kapelle.
Viele der Blöcke wurden später auch von Amenophis III. als Fundament für
seinen III. Pylon in Karnak (1).
Die
Rote Kapelle war ursprünglich 17,54m lang, 6,17m breit und 5,64m hoch. Die
Fassade des Vestibüls ist 7,70 m hoch, während die des Altarraumes nur 5,77
m hoch ist. Bei der Rekonstruktion der Roten Kapelle wurden
offensichtlich keine Decksteine für ein Dach gefunden worden -
möglicherweise ist die Kapelle nicht fertig gedeckt gewesen, obwohl rundum
auf dem Mauerwerk ausreichend Fläche als Auflage für ein Dach vorhanden
gewesen war.
Die zum Bau verwendeten Steine sind als
Baumaterial ungewöhnlich - sie bestehen hauptsächlich aus Quarzit (einem
silifizierten, sehr harten, orange-, rotbraunen und violettfarbenen Sandstein).
Dieser wurde eigentlich nur für Statuen benutzt - jedoch sehr selten für
Bauwerke. Andere Bauteile sind aus dunklem Diorit gearbeitet (wie die
Hohlkehlen, Kapellensockeln und Türeinfassungen, die gegenüber den bunten
Steinen wie ein schwarzer Rahmen wirken. Die äußeren Wände waren oben durch
sog. "Hohlkehlen" bekrönt, wobei aber nicht alle Rundstäbe an
allen Stellen fertig gestellt waren.
Eine Treppe mit sechs Stufen führt zum
Eingangsportal auf der Westseite der Kapelle. Das Gebäude besteht aus zwei
mit einem Fußboden gepflasterten Innenräumen: das Vestibül und das dahinter
befindliche Sanktuar (Heiligtum). Dieses war ursprünglich mit einer Tür
verschlossen und enthält an ihrer Ostseite einen weiteren Zugang. Die
Innenwände sind mit acht Bild- und Textregistern dekoriert.
Der gepflasterte Boden ist perfekt
aneinandergereiht - mit Ausnahme der zentralen Blöcke, die von einer Rinne
umgeben sind. Der zentrale Teil war also eindeutig dazu bestimmt, das
Reinigungswasser aufzunehmen, welches bei den rituellen Zeremonien verwendet
wurde
Charakteristische Merkmale der ägyptischen
Tempelbauarchitektur sind die Rundstäbe an den vier Ecken des leicht
geböschten Bauwerkes sowie die Hohlkehle als gewölbter Abschluss der oberen
Mauerteile.
Die Eingänge
Die Kapelle hat drei
Durchgänge (den Haupteingang auf der Westseite, den rückwärtigen Ausgang
auf der Ostseite und das innere Tor vom Vestibül ins Sanktuar) mit der gleichen Größe und alle lagen auf einer Ebene. Alle
Durchgänge wurden durch zweiflügelige Tore verschlossen, die sich nach innen
öffneten. (Quelle: Arnold, Lexikon der Ägyptologie, 2000). Oben
und unten hatten die Türflügel je einen Zapfen, wobei jeder Türflügel oben
mit dem oberen Zapfen in eine Bohrung des Türsturzes eingehängt wurde, wie
Dieter Arnold (Lexikon der Ägyptischen Baukunst, 2000) ausführt. Der
Türflügel wurde dann unten in einer Rinne im Boden eingeschoben und bis zum
Einrasten nach vorne geschoben bis zur endgültigen Position des
Türflügels.
|

|
Eingang Westseite der Roten
Kapelle
Türsturz
Die Torpfosten und der Türsturz
waren aus Grano-Diorit gearbeitet und die wenigen erhaltenen Inschriften
zeigen nur die Namen (Thron- u. Geburtsname) von Thutmosis III sowie die
üblichen Epitheta.
Foto: Courtesy to Elvira
Kronlob 2019
- alle Rechte vorbehalten - |
Die Türpfosten und Türstürze aus Diorit, welche
bereits die Namen von Thutmosis III. trugen wurden unmittelbar nach ihrer
Entfernung im Zusammenhang mit der Abtragung der Roten Kapelle unter Thutmosis
III. für dessen Neubauten im zentralen Bereich des Amun-Tempels
wiederverwendet. Das Osttor (siehe Bild unten) wurde in der Nordwand des
Korridors im Annalensaal und das westliche Tor (Bild oben) des Vestibüls im
südlichen Tor des 6. Pylons ein- und umgebaut (Quelle: Franck Burgos,
Francois Larché: La chapelle Rouge. Le sanktuaire de barqued'Hatschepsout,
Paris 2008, ISBN 978-2-86538-317-7-S. 11)
Die
Rote Kapelle - (Ostseite)
Treppe
mit Stufen - Rückseite
mit Durchblick auf des innere Tor ins Vestibül |
| Rückseite der Roten Kapelle mit
einer 5,77 m hohen Fassade, die somit nur geringfügig höher war als
die Kapelle selbst. Dieser Eingang führte zum Sanktuar.
Eine schmale Abflussrinne, die zur Aufnahme des
Wassers, das zur rituellen Reinigung im Sanktuar genutzt wurde, führt
um die östliche Basis eines Podestsockels im Inneren und durch die
östliche Tür (siehe Abfluss unterhalb der 3. Treppenstufe) nach draußen
auf die vorletzte Stufe. |
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob 2019
- alle Rechte vorbehalten - |
Vestibül:
Das Vestibül (Opfertischsaal) war
der Raum für die täglichen Opfergaben und Opfer-Rituale, wobei die
Opfergaben offenbar mit Wasser besprengt wurden, da links und rechts des
Hauptportals im Boden seitliche Abflussrinnen wegführten. Diese Rinnen
dienten zur Aufnahme des Wassers, dass bei den täglichen Kulthandlungen
verwendet wurden. Ein Abflusskanal führt von der Rinne um die östliche Basis
durch die östliche Tür nach draußen.
In der Mitte des Vestibüls befindet sich
eine 1,30 m x 0,80 m große und 0,5 m tiefe Dioritwanne. Sie trägt ein Dekor
aus Lattichpflanzen - evtl. hatte sie als Lattichbecken gedient. Im Sanktuar
ruhte die Barke des Amun-Re auf einem als Kapelle gestalteten Sockel, von dem
heute nur noch ein 0,20 m hoher Quarzitblock erhalten ist, der von einem
Abflusskanal umgeben ist. Dieses lässt vermuten, dass das tägliche
Reinigungsritual wohl im Sanktuar stattgefunden hatte.
|

|
Dioritbecken
aus dem Vestibül
Maße: 1,30 x 0,80 x 0,5 m
Dieser ausgehöhlte Block wurde 1995 -
auf der Ostseite von Karnak - in einem Loch vor dem Tor des Tempels
"Osiris von Koptos" gefunden und die Ägyptologen ordneten ihn
- aufgrund verschiedener Merkmale - der Roten Kapelle zu (siehe Larché
1999-2000). Larché vermutet, dass dieser Block bereits in der Antike
bei seiner Zweitverwendung ausgehöhlt wurde - ursprünglich aber
vielleicht ebenso wie die beiden anderen Socke im östlichen Teil der
Roten Kapelle entweder als Opfertisch oder Podest für die Barke diente.
Auf der Westseite des Diorit-Blocks
steht der Thron- und Geburtsname von Königin Hatschepsut. Die beiden
Schmalseiten sind mit einem Lattichfries verzieht.
Bild:
Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten -
|
Der Boden im Vestibül ist ca. 20 cm höher als
der im Sanktuar und die Stufe zum Sanktuar liegt genau im Durchgang. Sie
schloss mit der Tür ab. Man musste also vom Vestebül aus 20 cm hinabsteigen,
um ins Sanktuar zu gelangen und ebenso am anderen Ende eine Stufe wieder
hinaufsteigen, um die Türschwelle am östlichen Ende des Sanktuars nach
außen zu erreichen.
Interessanterweise befindet sich an der Stufe vom
Vestibül zum Sanktuar - auf der linken Seite (vom Sanktuar aus gesehen),
direkt über der Rinne für den Einschub des Türflügels die Kartusche von
Hatschepsut (2). Das Vestibül war
ursprünglich durch eine Tür vom Sanktuar abgetrennt. Heute sind nur noch
Teile der Türpfosten aus Diorit erhalten.
Sanktuar
Nur wenige Personen hatte zum Sanktuar (altägypt.:
"Set-Weret" / der Große Thron)
Zutritt. In diesem heiligen Raum ruhte die Barke des Amun auf einem als
Kapelle gestalteten Sockel, wie auf einem Thron. Von diesem Sockel ist heute
nur noch ein 0,20 m hoher Quarzitblock erhalten, der mit einem Lattichfries
dekoriert ist. Dieser Sockel bildete einst das Podest für den heute
verlorenen Barkensockel und ist von Abflussrinnen umgeben, die den Sockel
"umlaufen". Somit könnte das tägliche Reinigungsritual am Kultbild
tatsächlich im Sanktuar vollzogen worden sein.
In den Vertiefungen
vor der Plinthe des Barkensockels wurden - noch nach Tausenden von Jahren -
Metallspuren nachgewiesen, welche die vor dem Barkensockel aufgestellten
bronzenen oder kupfernen Opferständer mit langstieligen Lotosblumen gehalten
haben, wie es Reliefdarstellungen zeigen. Sicherlich wurden die Pflanzen
bewässert, worauf die Abflussrinnen, welche die Vertiefungen für die
Opferständer mit dem zentralen Abflusskanal verbinden, zeigen. Das Wasser
wurden im Abflusskanal gesammelt und unter der Schwelle des Ostportals nach
außen abgeleitet.
Nahe dem Durchgang
zum Vestibül - in der Zentralachse - befindet sich zudem ein
undekorierter Dioritsockel (10 cm hoch) der als Untersatz für einen
Opfertisch gedient haben könnte (Quelle: M. Schnittger, Hatschepsut. Eine
Frau als König von Ägypten, Darmstadt 2011, S. 101-103)
(Die Nummerierung der Blöcke folgt der
Arbeit des Architekten Francois Larché und und des Steinmetzes Franck Burgos
vom (CFEETK), welche die Rekonstruktion der Blöcke durchgeführt und 2001
abgeschlossen hatten und ihre Arbeit 2006 publiziert hatten). - (La chapelle
Rouge, Le saanctuarire de barque d'Hatshepsut, Paris 2006).
Bei
der Rekonstruktion der Kapelle zeigte sich, dass fast alle Reliefszenen
jeweils nur über einen Steinblock lang waren - äußerst selten auch
horizontal über zwei Blöcke. Die Steinblöcke, die in
"Ziegelbauweise" verlegt waren, waren einheitlich groß und ähnelten
den Talatat von Echnaton, so dass der Bau relativ einfach war - demzufolge
auch der Abbau unter Thutmosis III. Der Rote Quarzit kam aus den "Roten
Bergen" von Djebel Akhmar - nahe bei Heliopolis).
Die umlaufende Basis der Roten Kapelle
(unvollständig) aus Grano-Diorit zeigt Darstellungen der Wegestation der
Opet-Prozession zwischen Karnak- und dem Luxor-Tempel. Insgesamt ließ
Hatschepsut sechs Wegestationen errichten, die während der Prozession als
Ruhestationen für die Heilige Barke des Amun dienten, der über Land
durchgeführt wurde. Der Rückweg erfolgte auf dem Nil mit der Barke "Userhat-Amun".
Erst seit der Zeit von Tutanchamun wurden beide Prozessionswege auf dem Wasser
durchgeführt.
Auf den meisten Blöcken der Roten Kapelle sind
Hatschepsut alleine oder zusammen mit ihrem Co-Regenten Thutmosis III.
dargestellt. Sie zeigen diese bei verschiedenen rituellen Handlungen (wie beim
Opet-Fest oder bei einem Kultlauf oder in Verehrungsszenen vor Amun). Auf
einigen der Blöcken sind Zerstörungen der Figur von Hatschepsut zu sehen,
was oft als Hinweis auf eine sog. "Damnatio memoriae" während der
Alleinregierung von Thutmosis III. gedeutet wird. Evtl. hatte dieser aber nur
versucht, die Rote Kapelle als "sein Werk" und für sich alleine in
Besitz zu nehmen (siehe Chr. Meyer, 1989). Offensichtlich hatte Thutmosis -
nach dem Tod der Hatschepsut - versucht, das unfertige Bauwerk für sich zu
usurpieren, da er einige der Reliefs zu Ende dekorieren ließ. Man geht davon
aus, dass Thutmosis III. die Blöcke der obersten Abschlussreihe alleine
setzten ließ und mit dem Dekorationsprogramm an drei Blöcken des 7. und das
gesamte 8. Register auf der Abschlussreihe der Kapelle nach dem Tod der
Hatschepsut fortfuhr. Als Beleg dafür ist zu sehen, das er nur noch alleine
auftaucht. Einige Jahre nach dem Tod von Hatschepsut wurden die Arbeiten an
der Roten Kapelle schließlich eingestellt und später baute man die Kapelle
ganz ab.
Bei der Rekonstruktion der Kapelle zeigte es sich,
dass sich fast alle Reliefszenen nur jeweils über einen Steinblock
erstreckten - nur selten mal horizontal auch über zwei Blöcke - jedoch
niemals vertikal über mehrere Blöcke (mit Ausnahme der Torlaibungen)
(Quelle: 2).
Auf einem umlaufenden Band an der Kapellenbasis
(der Sockel und das 1. Register) aus fast schwarzem Diorit und kontrastierend
mit dem rotgelben Quarzit der restlichen Register sind auf allen Seiten der
Roten Kapelle personifizierte Provinzen von Ober- und Unterägypten oder
personifizierte Monumente zu sehen, die durch identische männliche, androgyne
Gestalten (des Nilgottes Hapi) dargestellt sind. Alle Tempel sind durch eine
"Hwt"-Hieroglyphe gekennzeichnet und durch wiederum identische
weibliche Figuren dargestellt. Alle Gestalten - männliche wie auch weibliche,
knien auf einem Tablett und halten zwei Vasen und ein Uräus-Szepter an ihren
Armen mit jeweils einem Band mit zwei Anch-Zeichen. Die Figuren werden durch
einen Namen über ihren Köpfen identifiziert: Namen der Gaue
(Verwaltungseinheiten) - alle Gaunamen sind auf der üblichen Standarte
monitert - Namen königlicher thebanischer Stiftungen, und Namen einiger
geografischer Einheiten. Ganz Ägypten kommt, um dem Gott Amun seine Produkte
und Erzeugnisse anzubieten.
| Das umlaufende Sockelband besteht aus Dioritblöcke
und zeigt auf allen Seiten der Roten Kapelle personifizierte Provinzen
von Ober- und Unterägypten (oder personifizierte Monumente, welche
ihre Erzeugnisse vor Amun bringen. Auf der Süd- als auch auf der
Nordseite schauen die Figuren nach Osten, auf der anderen
Fassadenseite der Kapelle zu den Toren hin.
Die Orte und Paläste sind durch eine gleiche männliche Gestalt
des Nilgottes Hapi gekennzeichnet und die "Hwt"- Glyphe (Palastglyphe)
wird durch eine weibliche Figur dargestellt. - beide Opfergestalten
sind kniend dargestellt und opfern auf ein Tablett mit zwei Vasen und
ein Was-Szepter. Von ihren Armen hängen jeweils zwei Anch-Zeichen.
Oberhalb der Gestalten befindet sich jeweils der Name des Tempels, des
Palastes oder des Gaus.
Auf dem rechten Block an der Basis wurde der Name der
Hatschepsut zerstört. Die Inschrift berichtet vom Herbeibringen alle
Nahrungsmittel und aller Opfergaben für den Tempel der Maat-ka-ra
(namens) Amun ist der Djeser Djeseru (der Allerheiligste).
Der linke Block nennt "den Kanal des Amun, rein und
kühl" in der rechten Spalte wird über das "Bringen des
jährlichen Einkommens, frisch und rein" berichtet.
Parade der Tempel, Paläste und Gaue: (Nordwand Mitte)
Darstellung einiger unterägyptischer Gaue (von rechts nach links): der
16. Gau Mendes ("Spitze des Speeres"); Gau Nr. 15: (Ibisgau)
Hermopolis; Gau Nr. 12: Sebennytos (Gau des Göttlichen Kälbchens); 10. Gau
Athribis (Gau des schwarzen Stieres) und ganz links: 11. Gau Pharbaethos (Hesbu)
(Quelle: www.maat-ka-ra.de)
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten -
|
Die dunkle Farbe des Diorits symbolisiert den
Untergrund aus Fruchtbarkeit bringendem Nilschlamm - aus dem der
Schöpfungslegende nach das Leben auf der Welt entstand. Der Sockel stellt die
stilisierte Palastfassade dar und definiert die Kapelle somit als "Palast
des Gottes". Das umlaufende Sockelband aus Grano-Diorit auf der Südwand
ist unvollständig, die Reihe ist hier mehrfach unterbrochen.
Auf der Außenfassade werden folgende (noch
erhaltene) Darstellungen gezeigt: (Quelle: deutsche Wikipedia, Rote Kapelle
Karnak)
- Register: (Sockel): Gau-Gottheiten, Tempeln,
Barkenstationen, Sumpfgebiete, Kanäle und Paläste als Gabenbringer
(siehe Bilder oben).
- Register: Einführung Hatschepsuts in die Rote
Kapelle, Hatschepsut im Tempel, "Großes Haus des Amun" und
historische Texte
- Register: West- und Ostfassade: Hatschepsut in
einem dreiteiligen Ritual vor Amun, Anbetung, Ruderlauf und Umarmung,
Nord- u. Südfassade: Opetfest, Prozession nach Luxor, Talfest, Prozession
nach Deir el Bahari
- Register: Hatschepsut bei Opferhandlungen vor
Amun, Amun in seiner normalen Form und in der Gestalt des Amun-Min
- Register: West- u. Ostfassade: Hatschepsut bei
dreiteiligem Ritual vor Amun, Anbetung, Hes-Vasen-Lauf und Umarmung.
Nord- u. Südfassade: Opetfest, Rückkehr von Luxor, Talfest, Rückkehr
von Deir el-Bahari
- Register: West- u. Ostfassade: Hatschepsut bei
Tier- und Weinopfer vor Amun - Nord- und Südfassade: Opfer vor Amun und
der Neunheit
von Heliopolis
- Register: Krönung Hatschepsut
- Register: Krönung Thutmosis III.
- Register: Nur Westfassade: Thutmosis III.
Krönungszeremonien
Im Tempel von Deir el Bahari befindet sich ein Text über
die Krönung von Hatschepsut. Ein weiterer - besser erhaltener -
Krönungsbericht hat sich auf den Außenwänden der Roten Kapelle erhalten
(Register 7). Zwei stark zerstörte Blöcke auf der Südseite zeigen eine
selten belegte Krönungssequenz, die mit der Einführung der Krönungsorte
beginnt, wo die heilige Handlung vollzogen wird. Die Zeremonie wird auf dem
Block 172 vor den beiden obersten Göttern der großen religiösen Zentren
(Heliopolis im Norden und Karnak im Süden) Atum und Amun vollzogen. Diese
halten die Königin auf dem linken Block an ihren Händen - geleitet durch
zwei königliche Standarten (der Schakalgott Upuaut, dem
"Wegeöffner" und die hintere mit dem "Sched-sched-Symbol"
und führen sie zum Tempel. Der Text (stark zerstört) enthält eine
Reinigungsinschrift: "Einführen des Königs in das Per-we und indas
Per-neser - in das oberägyptische und das unterägyptische Heiligtum.
Dahinter befindet sich der Gott Thot, Herr von Hermopolis, der die
Regierungsjahre Hatschepsuts auf eine Palmrispe schreibt und ihre Sedfeste
(Thronjubiläen) festlegt.
|
Rote Kapelle - Open Air Museum -
Südliche Außenwand |
| Auf dem
nachfolgendem Block Nr. 261 (Südwand, 7. Register) folgt die Krönung
selbst, in der Amun ein Nemes-Kopftuch (nms) auf dem Kopf der
Königin befestigt. Hatschepssut kniet im "pr-wr" vor
Amun. Vor ihr steht die löwenköpfige Göttin Weret-Hekau
"Herrin des Himmels, Königin der Beiden Länder". |
Die Darstellungen auf der West- und Ostfassade
Die Darstellungen auf der West- und
Ostfassade (dem Ein- und Ausgang der Kapelle) sind ohne Bezug zu den Szenen
auf der Süd- und Nordseite der Roten Kapelle angeordnet worden. Nur auf dem
1. Register setzt sich umlaufend auf allen 4 Seiten die Prozession der Gaue
und Tempeln fort.
Sowohl die West- als auch die Ostfassade sind fast
mit einem identischen Aufbau versehen - in den Registern 2 - 7 befinden sich
korrespondierende Szenen. Das 8. Register zeigt unterschiedliche Szenen. Nur
die Westseite besitzt auch noch über ein 9. Register, da sie höher ist als
die Ostfassade. Die Szenen auf der Nord- und Südhälfte beider Fassaden -
getrennt durch die Eingänge, sind identisch dekoriert mit wiederholten Szenen
- mit einem einzigen Unterschied: der König auf der Südhälfte von beiden
Fassaden trägt die weiße Doppelkrone von Oberägypten und der König auf der
Nordhälfte der Fassade die Rote Krone von Unterägypten.
Das Bildprogramm auf der West- und
Ostfassade der Tore:
| Sockel |
Palastfassaden-Motiv |
| 1. Register |
Gaugottheiten, Tempel und Kanäle als
Gabenbringer |
| 2. Register |
Einführung von Hatschepsut in die Rote
Kapelle und Hatschepsut im Tempel "Große Haus des Amun". |
| 3. Register |
Dreiteiliges Ritual vor Amun -
Hatschepsut bei Anbetung - Ruderlauf und Umarmung durch den Gott |
| 4. Register |
Hatschepsut - Opferhandlung vor Amun
(Tieropfer u. Weihrauch) |
| 5. Register |
Dreiteiliges Ritual vor Amun -
Hatschepsut anbetend - beim Vasenlauf und bei Umarmung durch den Gott |
| 6. Register |
Hatschepsut bei zwei Opferhandlungen vor
Amun - Tieropfer und Weinopfer |
| 7. Register |
Krönungsszenen der Hatschepsut |
| 8. Register |
Krönung Thutmosis III. |
| 9. Register |
Thutmosis III. |
Rote Kapelle - Open Air Museum - Fassade
westliches Tor/Nordhälfte / 4 Blöcke
- Opferhandlungen und Rituallauf vor dem ithypallischen Amun - |
| Die Darstellungen auf dem Westtor der
Kapelle aus rotem Quarzit (Herkunft aus den "Roten Bergen"
von Djebel Akhmar bei Heliopolis) zeigen oben links eine
Opferszene: rechte Seite der ithypallische Amun und links Hatschepsut,
die vier Opferstiere opfert. Hinter der Königin steht ihr Ka als
Standarte.
Der Block rechts oben zeigt links die "Gute
Göttin" Maat-ka-ra beim Weihrauchopfer vor Amun, dem "Herrn
des Himmels" (rechts).
Die Blöcke unten zeigen links: die "Gute
Göttin" Maat-ka-ra, die den ihr gegenüber stehenden Gott Amun
anbetet.
Rechts wird die "Gute Göttin" Maat-ka-ra von
Amun-Ra, "Er, der das Herz befriedigt" umarmt. Links davon
ist die "Tochter des Ra" Hatschepsut beim Ruderlauf vor dem
ithypallischen Amun, dem "Herrn der Throne der Beiden
Länder" zu sehen. Sie hält in ihren Händen ein Ruder mit dem
Blatt nach unten und in ihrer Linken Hand ein seltsam abgewinkeltes
Instrument, das nach Hannig (Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch, 1995,
S. 1101) die Hieroglyphe A5 darstellt - möglicherweise ein
Instrument zur Steuerung eines Schiffes. Die Königin trägt die Rote
Krone von Unterägypten - was zum nördlichen Landesteil passt. Die
Beischrift besagt, dass sie von Amun begrüßt wird: Sei mir
willkommen, geliebte Tochter Maat-ka-ra, in Frieden, die meinen Leib
öffnet".
|
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Das Bildprogramm auf der Nordseite der
Kapelle
Die Fassaden der Nord- und Südseite
der Kapelle zeigen (insbesondere im 3. und 5. Register) im Wesentlichen den
Festtagskult, die großen Zeremonien der Königsherrschaft. Erstmals werden
sie unter Hatschepsut dokumentiert: das Opetfest von Luxor und das seit dem
Mittleren Reich bekannte Talfest von Deir el Bahari. Auch das seit der
Frühzeit belegte königliche Thronjubiläum, das Sedfest spielt in dem
Festtagskult eine besondere Rolle. Auf den Blöcken der Roten Kapelle ist
dieses aber nur in Einzelszenen dargestellt.
Im Mittelpunkt der Darstellungen stehen
auf der Nord- und Südseite der Roten Kapelle die Prozessionen anlässlich von
Götterfesten mit den dazugehörigen Festumzügen und den Kulthandlungen. Auf
der Nordseite sind das im 3. und 5 Register das "Fest vom schönen
Wüstental", das von Karnak aus über den Nil zum Tempel der Königin nach
Deir el Bahari führt. Im 3. Register ist jeweils der Auszug der Prozession
vom Karnaktempel aus und im 5. Register ihre Rückkehr dargestellt.
Rote Kapelle - Open Air Museum
- Großes Festopfer
Nordwand, 3. Register, Block 273 - linke Seite |
Großes Festopfer vor dem Sanktuar
des Amun-Re in Deir el Bahari. Hatschepsut (vorne) und Thutmosis III.
(dahinter) weihen 4 Register in verschwenderischer Fülle mit
Opfergaben: im untersten Register sehen wir Geflügel aller Art, im 2.
Register darüber Lieberationsgefäße auf Ständern (Nemset- und
schlanke hes-Vasen), die mit Wasser gefüllt sind, im 3. Register
Rinderschenkel, Obst und Gemüse und Brote und im obersten Register
mit Blumen verzierte Vasen, Getreidesorten und ein Ständer mit "nun"-Topfen
und darüber gekreuzten Lotusblüten.
Thutmosis gibt eine Weihrauchspende. Vor Hatschepsut steht eine
Ritualanweisung: "Viermaliges Weihen des Großen Opfers für
Amun-Re, während (er) ruht in Djeser-Djeseru Amun". Hinter
Thutmosis III. steht das Epitheton "An der Spitze der Kas aller
Lebenden". Hatschepsut hält Szepter und Hedj-Keule in
ihren Händen.
|
Bild: Markh, engl.,
Wikipedia, 2005 public domain |
Rote Kapelle - Open Air Museum
- Großes Festopfer
Nordwand, Block 40 - 3. Register |
Der Block 40 zeigt (lt. der
Beischrift vor der Götterbarke) Festival-Aktivitäten aus dem
"Schönen Fest vom Wüstental" - das "Herauskommen der
Prozession aus dem Tempel von Karnak" und aus der Beischrift
hinter der Barke ist zu lesen "das Schreiten des Prozessionszuges
zum Ufer des Kanals, um mit dem Schiff zum Tempel von Djeser-Djeseru
zu fahren".
Auf der rechten Seite des Bildes steht Thutmosis III. (lt.
Beischrift) "Der König von Ober- und Unterägypten, Herr des
Ausführens der Kulthandlungen, Men-cheper-Ra, dem Leben, Dauer und
Macht gegeben ist, wie Ra". Lt. Beischrift unter seiner Hand
bringt er ein Weihrauchopfer dar.
Vor ihm stand original die Königin (Hatschepsut), deren Figur
vollständig getilgt worden ist.
|
Bild: Cortesy to
Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Aus den Folgen der Szenen wird deutlich, dass die
Darstellungen auf der Roten Kapelle von unten nach oben gelesen werden
müssen. Im 3. Register (von unten) befinden sich die Szenen mit dem Auszug
der Prozession aus dem Karnaktempel (/siehe Bilder oben) und im 5. Register
wird jeweils die Rückkehr vom Djeser Djeseru über den Nil nach Karnak
dargestellt (siehe Bilder unten).
|
Rote Kapelle - Nordfassade - das "Schöne
Feste vom Wüstental" |
| Register 5 (Block 126): Rückkehr vom Djeser Djeseru
(Totentempel) in Deir el Bahari. Die Prozession (rechtes Bild)
befindet sich noch auf der Westseite des Nils. Lt. Inschrift tragen
die Priester die "Barke des Amun auf dem Landweg zum Kanal".
Hatschepsut und Thutmosis III. folgen der Barke.
Register 5 (Block 291): - links: Die Barke des Amun
(beschädigt) befindet sich auf dem Schiff des Amun-Re "Userhat-Amun"
und wird über den Nil transportiert. Thutmosis III. steht rechts
hinter dem Barkenschrein am Ruder. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Rote Kapelle - Open Air Museum
- Nordwand, Register 5. und 6.
- Opferhandlungen und Rückkehr der Barke von Deir el Bahari nach dem
Karnaktempel - |
| Im oberen 6. Register steht
Hatschepsut links auf dem Block 257 vor dem Gott Atum, "dem Herrn
der beiden Länder, dem Herrn von Heliopolis" (links) und bringt
ihm ein Weihrauchopfer dar (Beischrift unter der Opfergabe) Auf dem
rechten Block (193) steht die Königin vor dem Gott Month, dem Herrn
von Theben", der links von ihr steht und spendet Wasser. Hinter
Hatschepsut steht ihr königlicher Ka.
Block 303 im 5. Register zeigt eine Festivalszene und
zwar vom "schönen Fest vom Wüstental". Links im Bild steht
Hatschepsut (vorne) und hinter ihr Thutmosis III., der lt. der
Beischrift unter seinen Händen ein Weihrauchopfer für Amun-Re
darbringt. Vor ihm steht die "Gute Göttin, Herrin der Beiden
Länder, Maat-ka-Ra", welche 4 Kästen - die jeweils auf einem
Schlitten montiert und mit Straußenfeldern der Maat dekoriert sind
und weiht die Kästen für Amun-Re.
Rechts im Bild ist die Prozessionsbarke des Amun-Re zu sehen.
Bug und Heck der Barke sind mit einem Widderkopf dekoriert - jeder der
Köpfe ist mit einem Uräus gekrönt, der in einem Gehörn eine
Sonnenscheibe trägt. Unter einem Baldachin steht ein Naos, der eine
Götterstatue enthält. Der Naos enthält die Form des
oberägyptischen "pr-wr"-Heiligtums.
Die Prozessionsbarke wird von mehreren Priestern - darunter zwei
Sem-Priester (erkennbar in der Mitte an ihren Pantherköpfen am
Gürtel) getragen. Der 3. Priester vorne trägt einen Wedel und vor
ihm steht eine Schutzformel.
Vorne auf der Barke steht die Besatzung - eine Göttin mit
Hathor-Gehörn und Sonnenscheibe steht hinter dem Widderkopf am Bug,
daneben steht Maat, die an ihrer Feder zu erkennen ist. Hinter den
beiden Göttinnen folgt ein Königssymbol auf einer Standarte (eine
menschenköpfige Sphinxfigur mit Doppelfederkrone und dem gekrümmten
Götterbart.
Dahinter folgen 3 in Richtung des Götterschreins gewendete
Figuren: eine Königsgestalt mit einem "nemes"-Kopftuch, der
zwei "nun"-Gefäße vor dem Naos opfert; davor eine weitere
menschenköpfige Sphinxfigur, die einen Krug hält. Direkt vor dem
Naos - und auch dahinter am Heck - kniet jeweils eine Figur, welch
anscheinend die Standen des Baldachin festhält.
Auf dem Heck der Barke befindet sich auch noch ein Steuermann.
(2). |
Bild: Courtesy
Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Rote Kapelle /Nord-Wand - Das "Schöne Fest
vom Wüstental"
- Nordfassade, 5. Register, Block 61 und 128 - |
| Die Prozession ist nun ans Ziel
gelangt. Nach der Rückkehr der Barken folgt der feierliche Empfang im
Karnaktempel, wo das Fest "vom schönen Wüstental" seinen
Höhepunkt erreicht. Der linke Block (61) zeigt Musik und Tanz - ein
blinder Hafner singt ein Lied und hinter ihm werden Tänzer und
Tänzerinnen bei einem sakralen Tanz, den die Beischrift als
"Tanz der Tänzerinnen" beschreibt, dargestellt. Sechs fast
unbekleidete Tänzer und Tänzerinnen werden hier in einem
"Überschlag nach rückwärts mit wehenden Haaren" gezeigt.
Hinter ihnen stehen zwei nach vorn gebeugte Frauen, die lt. Emma
Brunner-Traut "in einem Zustand der religiösen Verzückung"
sind. Im unteren Register sehen wir drei weibliche
Sistrumspielerinnen und drei männliche Taktgeber. Ganz links befinden
sich zwei weitere tanzende Priester, welche in der Beischrift mit
"Tanz der Tänzer" beschrieben werden.
Rechter Block:
Auf dem sich nach rechts anschließenden Block (Nr. 128) sehen wir
die Barke des Amun, welche nach ihrer Rückkehr in die
"Alabaster-Kapelle" von Amenophis I. mit dem Namen
"Bleibend ist das Denkmal des Amun" aufgestellt wurde.
Hierbei handelt es sich aber nicht um eine der Barkenstationen am Prozessionsweg,
noch um eine der von Hatschepsut erbauten Sanktuare, da den Namen
ihrer Kapelle immer ihr Thronname vorangestellt wurde. Wahrscheinlich
war diese Kapelle zur Zeit von Hatschepsut noch in den Opferkult mit
einbezogen.
Die Szene auf diesem Block ist spiegelbildlich zur Darstellung
des Blocks 102 auf der Südwand, so dass beide in die gleichre
Richtung weisen (2). Im Unterschied zur Darstellung auf der südlichen
Wand trägt die Königin hier die Rote Krone. Die Inschrift rechts
unter der Barke lautet: "Halt machen / Haltepunkt im Tempel / aus
Alabaster "Bleibend ist das Denkmal Amuns" (Übersetzung
Michael Tilgner).
Vor der Barke steht links ein bauchiger "nemeset"-Krug
und zwei hohe Opferständer und die Königin mit einem Apis-Stier im
Kultlauf. Dieser Kultlauf ist ein sehr altes Ritual - wobei hier aber
immer nur Hatschepsut als König bei den Kultläufen auftritt, niemals
Thutmosis III. Die Beischrift vor der Königin lautet: "Feld
übergeben, viermal" und über dem Stier lautet: "Lauf
des Apis-Stier". |
|
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
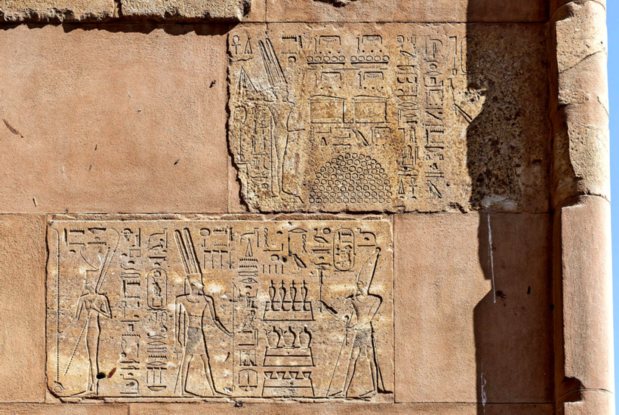
|
Nordwand der Roten Kapelle
7. und 6. Register (Roter Quarzit)
Das Bild im 6. Register (unten auf dem Bild) zeigt
den Block 207 - der Abschlussblock rechts davon fehlt. Hatschepsut
("Tochter des Re - geliebt von ihm ewiglich) weiht hier einen
Stapel von Opfergaben, darunter Vasen, an Amun, den König der Götter,
hinter dem die Göttin Amunet, nach links gewendet steht.
7. Register: (oben) - der Block 53 darüber zeigt
Hatschepsut (rechts), die einen Stapel Gold an den ithypallischen Gott
Amun "Herr der Throne der beiden Länder" weiht.
Auf der rechten Bildseite ist der Abschluss der Wand durch den Rundstab
zu sehen.
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten |
Südwand:
Während auf der Nordfassade in den
Registern 3 + 5 das "Fest vom Schönen Wüstental" dargestellt wird,
das von Karnak aus über den Nil u. a. zum Totentempel in Deir el Bahari und
zurück dargestellt wird, zeigen die Bilder auf der Südfassade im 3. und 5.
Register die "Opetfest-Prozession" zum Tempel von Luxor. Das
"Opetfest" war in der Pharaonischen Zeit das bedeutendste und
längste der jährlichen Feste in Theben und ist erstmals unter Hatschepsut
belegt und auch auf den Quarzitblöcken der Roten Kapelle ausführlich
dargestellt worden.
Gewidmet ist das Opetfest dem Gott Amun von
Karnak. Dieser besuchte alljährlich das Heiligtum des "Südlichen
Opet" (in Hieroglyphen.: Jp.t-rsj.t) -
welches heute der Tempel von Luxor ist, der als seine Geburtsstätte gilt. Das
südliche Opet wird auch allgemein als Südliche Residenz oder Südliches
Heiligtum des Amun von Karnak gedeutet. Die Darstellungen auf den Blöcken der
Roten Kapelle berichten uns viele Einzelheiten über den Verlauf der
Prozession von Karnak nach Luxor und die Reise auf dem Nil zurück (4).
Den Höhepunkt dieses
mystischen Rituals bildete die persönliche Begegnung des Königs mit dem Gott
Amun-Re von Karnak in dessen Barkensanktuar, wo die göttliche Kraft des
Königs sich erneuerte. Sein "Ka" vereinigte sich mit dem seiner
königlichen Vorfahren und die göttliche Kraft ging auf den König über. Die
geheimen Riten und Mysterien wurden weder bildlich noch textlich
wiedergegeben. Es wird aber detailliert über die öffentlichen Prozessionen
berichtet. Nach der persönlichen Begegnung mit dem Gott verlässt
der König die geheimen
Räume und präsentierte sich einem ausgewählten Kreis von Würdenträgern
(den Priestern und hohen Amtsträgern) als ein verjüngter und mit der
göttlichen Macht neu aufgeladener König (4).
Rote Kapelle -
Südwand mit Opet-Prozession / Block 135 |
| Block Nr. 135 im 3. Register zeigt die
Opet-Prozession vom Karnak-Tempel auf dem Landweg zum Luxortempel -
entlang der 6 Wegestationen (Barkenschreine) der Hatschepsut. Die
Königin (ganz links) vollzieht ein "Weihrauch-Opfer" (jr.t
snTr n Jmn-Ra" für Amun-Re (Weihrauch spenden für
Amun-Re).
In allen Darstellungen trägt die Barke des Amun an Bug und Heck
einen Widderkopf, der in Fahrtrichtung schaute. Rechts neben der Barke
steht eine der Osiris-Figuren von Hatschepsut.
Die Barke wurde kurzfristig in der 4. Wegestation auf dem Weg
zum Luxortempel abgestellt. Der Name der Station lautet: "Die 4.
Station der Maat-ka-re, die das das Ruder oder den Arm (?) des Amun
kühlt" (nach Nims, 1955) (2) (Inschrift auf der linken Seite
neben dem Podest.
Vorne am Bug befindet sich die Besatzung der Barke, die
ausschließlich aus Göttern und Königen besteht, kleinen Figuren,
die wohl aus Gold oder zumindest vergoldet waren. Am Rumpf der Barke
befindet sich ein Udjat-Auge als Schutzsymbol - eine Besonderheit der
Zeit von Hatschepsut. Es ist in dieser Funktion weder bei ihrem Vater
Thutmosis I. noch bei ihrem Gatten Thutmosis II. oder ihrem Nachfolger
Thutmosis III. zu sehen - erst bei Tutanchamun schmückt den Rumpf
seiner Amun-Barke wieder dieses Schutzsymbol, das bis ans Ende der 18.
Dynastie beibehalten wurde (4). |
|
Bilder: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Neben den Darstellungen des
"Opetfestes" zeigen die Bilder auf der Südwand auch den Weg der
Prozession von Karnak nach Luxor, der von sechs gleich gestalteten
Wegestationen (Stationskapellen) der Hatschepsut gesäumt wurde, die auch
archäologisch nachgewiesen werden konnten. Fünf dieser Stationskapellen oder
Barkenstationen sind auf den Darstellungen der Roten Kapelle erhalten
geblieben. Die Träger konnten dort die Barke absetzen und sich ausruhen,
während die notwendigen Kulthandlungen vollzogen wurden (1). Die 1.
Wegestation, deren Name lt. Inschrift "Amun von der Treppe vor dem pr-hn
lautet (nach Otto 1952) wurde von den Bauforschern an der Westseite des
Heiligen Sees gefunden, direkt vor dem Tempel der Mut - gegenüber dem kleinen
Tempel des Kamutef. Auf der Roten Kapelle ist sie auf der Südfassade im 3.
Register dargestellt und namentlich genannt (Block 300). Thutmosis III.
verbrennt Weihrauch vor der Barke, die danach in der Barkenstation abgestellt
wird. Auf der linken Seite der Barkenstation steht Hatschepsut und opfert
Weihrauch
|
Rote Kapelle - Südseite
mit Sockelband aus Diorit |
| Die Blöcke aus rotem Quarzit aus den "Roten
Bergen" von Djebel Akhmar/nahe Heliopolis zeigen auf der rechten
Seite der Südwand - über der Sockelleiste aus Diorit - zeigen im 2.
und 3. Register einen Orakeltext während einer Prozession nach
Karnak, der sich über die gesamte untere Reihe auf der Südseite
streckt und sich mit der Erwählung von Hatschepsut zum König
durch ein Orakel des Amun-Re beschäftigt.
Im 3. Register (über dem Orakeltext) wird die Opet-Prozession
vom Karnak-Tempel nach Luxor - entlang der 6 Barkenstationen der
Hatschepsut dargestellt (Block 226). Sie beginnt rechts im 3. Register
mit dem Auszug aus der Barken aus dem Tempel von Karnak. Die Barken
werden hier von den Priestern auf ihren Schultern getragen. Einige der
Reliefs wurden zerstört (vor dem Podest der Barke des Amun aus auch
beim Prozessionszug). |
|
Bilder: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Außer der 1. Wegestation
der Prozession aus der Zeit der Hatschepsut ist nur noch die letzte der sechs
Barkenstationen bekannt - diese steht heute im Bereich des Luxor-Tempels und
wurde in der 19. Dynastie von Ramses II. in seinen großen Vorhof mit
eingebaut bzw. zu einer 3-Räume-Kapelle mit eigenen Barkenräumen für Amun,
Mut und Chons umgebaut. Nur noch die 4 zierlichen Papyrusbündelsäulen aus
rotem Granit und der Architrav stammen aus der Zeit von Hatschepsut.
Die Rückkehr der
Prozession zum Karnak-Tempel erfolgte im Gegensatz zum Auszug auf der Hinreise
zum Luxor-Tempel überwiegend auf dem Nil. Die Barke wurde an der Anlegestelle
am Nil auf das große Schiff des Amun mit dem Namen "Amun-Userhat"
verladen und dann zum Kai des Karnak-Tempels gerudert. Der letzte Abschnitt
der Strecke zurück zur Roten Kapelle erfolgte wieder auf den Schultern der
Priester (1).
Auf der linken Seite der
Südwand befindet sich auch eine Stiftungs-Darstellung über die
"Errichtung der beiden Obelisken", in denen Hatschepsut sich für
die Weihegaben für ihren "Vater" Amun lobt, was wohl ein Teil ihres
Legitimationsprogramms ist. Die Szene zeigt auf der linken Seite den
"Vollkommenen Gott, Herrin der Beiden Länder, Maat-ka-ra" vor den
beiden gestifteten Obelisken - während auf der rechten Seite des Blocks
Amun-Re die Stiftungsgaben (die beiden Obelisken) in Empfang nimmt. Die
Beischrift besagt, dass der König/die Königin selbst die 2 großen Obelisken
für den Vater Amun-Re vor "der Erhabenen Säulenhalle" (Wadjit-Halle)
errichten ließ, "die ganz mit Elektron umkleidet waren und deren Höhe
den Himmel erreichten und die Beiden Länder erhellten, wie Aton. Niemals
geschah dergleichen seit der Urzeit des Landes. Ihr möge Leben gegeben
werden, ewiglich".
Vestibül
Das
"Vestibül" (altägyptisch: wesechet-hetep / wsx.t-Htp)
hat die Funktion eines Opfertischsaals und ist der Raum für die täglichen
Opfergaben, Opferweihungen und Opferrituale. Die Ägyptologen nehmen an, dass
die Opfergaben hier wohl mit Wasser besprengt wurden, das dann durch die
rechts und links des Hauptportals im Boden sichtbaren seitlichen Abflussrinnen
das überschüssige Wasser nach draußen geleitet wurde.
Im Bildprogramm
des Vestibüls waren die Architekten der Kapelle bemüht - gemäß dem
Prinzip, das Bildprogramm nach seiner Funktion zu gestalten - die Wandreliefs
mit der Darstellung des gesamten Opferrituals in möglichst vielen
Einzelbildern zu dekorieren - ergänzt durch Reinigungszeremonien für den
Eintritt ins Allerheiligste und mit den Tempelgründungsritualen.
Das Vestibül der
Roten Kapelle besaß keine Sockelzone, sondern zeigt im 1. Register
"Besucher", die nur in diesem Raum der Roten Kapelle zu finden sind
(4). Es sind die sog. "Rechit-Vögel" (wird mit "Kiebitz /
Kiebitzvolk" übersetzt und steht u. a. für die Untertanen des Königs,
Hörige, oder auch nur für "Menschen". Die Darstellung des
Rechit-Vogels auf dem "nb"-Zeichen
(Korbhieroglyphe) mit zur Anbetung erhobenen Händen, meist vor dem
Königsnamen, stellt nach allgemeiner Auffassung die Anbetung des Volkes an
den König dar - als symbolische Präsenz des Volkes. Wo immer das Symbol der
Rechit-Vögel im Tempelbereich auftaucht, weist es auf die Orte hin, an denen
ein größerer Personenkreis als das sonst im sehr strengen Tempelreglement
zugelassen wurde oder das Volk zumindest symbolisch präsent war (4).
|
Umlaufender Fries im Vestibül der Roten Kapelle
mit Rechit-Vögeln - 1. Register, Block 38 |
|
Die gekreuzten Flügel der "Rechit-Vögel"
auf dem unteren Fries in dem Vestibül sind auf dem Rücken
zusammengebunden. Die menschlichen Arme und Hände sind anbetend erhoben
(erst seit der 18. Dynastie - vorher waren sie tiergestaltig). Diese
Darstellungen sind ein Symbol für die anbetenden Untertanen. Dieser
wunderschöne "Rebus" - die Vögel auf dem "neb"-Korb
- alles vor einem fünfzackigen Stern, welcher "anbeten"
bedeutet. |
|
Bild: Courtesy Elvira Kronlob, Engelskirchen |
Tabelle mit den Szenen auf den Wänden des
Vestibüls:
(Tabelle nach 4 und 2)
| Register |
Südwand
|
Nordwand |
| 8 |
Thutmosis III. beim Opfer vor Amun |
Thutmosis III. beim Opfer vor Amun |
| 7 |
Hatschepsut in Ritual und Opfer vor Amun
und Amaunet |
Hatschepsut in Ritual und Opfer vor
Amaunet |
| 6 |
Hatschepsut beim täglichen
Kultbildritual vor Amun |
Hatschepsut beim täglichen
Kultbildritual vor Amun |
| 5 |
Kultläufe - Vasenlauf |
Kultläufe - Ruderlauf |
| 4 |
Hatschepsut [opfernd] vor Amun und
Amaunet |
Hatschepsut [opfernd] vor Amun und
Amaunet |
| 3 |
Reinigungsrituale und [opfernd] vor Amun |
Einzug in den Tempel, Festschreibung der
Jahre |
| 2 |
Hatschepsut beim Eintritt in das
Vestibül |
Tempelgründungsrituale |
| 1 |
Es sind keine Blöcke auf der
Südwand vom Sockel erhalten geblieben. Vermutlich waren hier aber -
ebenso wie auf der Nordwand "rechit"-Vögel auf dem
Nb-Zeichen, anbetend vor [Amun] dargestellt. |
Rote Kapelle, Innere Nordwand des
Vestibüls / 6. - 8. Register (von unten nach oben) |
von rechts nach links - oben: Block
231, 224, 310, 224 - darunter: 7. Register: Block 153, 100
- 6. Register: Block 162, 15 |
| Auf ihren Darstellungen in der Roten Kapelle betonte
Hatschepsut nicht nur die Nähe zu ihrem göttlichen Vater Amun-Re,
sondern auch ihre Bindung an die weiblichen Gottheiten, insbesondere
ihre Bindung an Hathor, die uns auch aus den Bildern in dem Totentempel
von Hatschepsut bekannt ist. Weniger bekannt ist die Rolle der Göttin
Amaunet, die wir hier in den Bildern der Roten Kapelle sehen ebenso wie
die der Göttin Mut, der als "Mutter" übersetzt werden kann
und die auch im Amun-Tempel in Karnak eine wichtige Rolle spielt.
Block 231 - rechts oben:
Die Bilder im obersten Register zeigen ausschließlich Thutmosis und
wurden wohl erst nach dem Tod von Hatschepsut dekoriert (oder
hinzugefügt). Auf dem Block 231 sehen wir Thutmosis III., der Amun-Ra,
dem Herrn des Himmels, zwei Gefäße mit Milch darbringt.
Block 224 - links daneben:
Thutmosis III. weiht 4 x 3 Tische, die mit Gefäßen für Amun-Re
bepackt sind. Hinter ihm befindet sich sein Ka.
Block 310 - ganz links:
Thutmosis III. präsentiert drei Opferaufstellungen for dem
ithypallischen Amun-Re, König der Götter.
Block 153 - Register darunter rechts:
Der Block ist zweigeteilt: rechts steht Hatschepsut (mit dem "nemes"-Kopftuch
und dem Uräus) vor der Göttin Amaunet, Herrin des Himmels, die in
Karnak residiert, und wird umarmt.
Block 100 - in der Mitte:
Hatschepsut kniet mit 2 Gefäßen Wein in den Händen, bekleidet mit
"nemes"-Kopftuch und Uraeus vor einem dreistöckigen
Opferaufbau und bringt diesen dem ithypallischen Gott Amun-Re dar. Auf
dem Opferaufbau befinden sich drei Reihen mit Gaben, darunter ein Stier,
Gemüse, Brot, Enten etc.
Block 162 + 15 - Register 6:
Auf dem Block 162 im 6. Register opfert Hatschepsut - mit dem "nemes"-Kopftuch
und dem Uräus - lt. der Beischrift zwischen König und Gott, zwei
Gefäße mit Weihrauch an den ithypallischen Amun-Re, Erster der Beiden
Länder, Herr des Himmels, Fürst von Heliopolis. |
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Sanktuar:
Nur wenige Personen hatte Zugang zum Sanktuar. Hier
ruhte die Barke des Amun-Re auf einem als Kapelle gestalteten Sockel - wie auf
einem Thron. Die Dekoration im Inneren des Sanktuars zeigt im 3., 4. und 6.
Register auf der Nordwand Szenen des täglichen Rituals am Götterbild, sie
sie die Priester jeden Morgen - als Vertreter des Königs - durchführten. Man
nahm die Figur der Gottheit (in Gestalt ihres Kultbildes) vorsichtig aus dem
Schrein, reinigte und salbte sie und kleidete sie an. Danach wurde sie mit
Nahrung versorgt. Musikalische Darbietungen begleiteten häufig das Ritual
durch Sänger und Sängerinnen mit Sistren (Rasseninstrumente der Göttin
Hathor).
Der heutige Tourist, der die Rote Kapelle durch
das Portal auf der westlichen Seite betritt, schreitet nach Osten durch das
Vestibül in Richtung des Barkensockels ins Innere. Ihn erwarten auf den
Wänden im Sanktuar unterschiedliche Darstellungen: auf der Nordwand lebhafte,
abwechslungsreiche Szenen der verschiedenen Rituale. Viele davon zeigen die
Königin vor den Göttern, aber auch die täglichen Kulthandlungen, die im
Tempel von Karnak (aber nicht in der Roten Kapelle) vollzogen wurden.
Im 5. Register auf der Süd- und Nordwand
des Sanktuars wird die zentrale Szene im Inneren dargestellt, deren einziges
und vielfach variiendes Thema die Königin Hatschepsut selbst ist, doppelt und
in Begleitung ihrer Ka-Statue, beim Opfer vor dem Gott Amun-Re. Dieser ruht in
seinem Schrein in seiner Barke, mitsamt der beiden Tragestangen auf dem
kapellenartigen Sockel steht. Darunter befinden sich die Hieroglyphen für die
Göttin Maat und davor typische Opferständer mit den Lotos-Stängeln. Zwar
tragen die beiden Figuren der Hatschepsut den gleichen Königsschurz, aber der
Kopfschmuck ist unterschiedlich, vorne die einfache, kurze Lockenperücke und
hinten das königliche Chat-Kopftuch.
|
Rote Kapelle Karnak - Sanktuar / Nordseite -
Block 31 |
| Auf diesem Block erscheint Hatschepsut zweimal und
in Begleitung ihrer "Ka-Standarte" beim Opfer vor der aufgeständerten Barke des Amun, die mitsamt den beiden Tragestangen
auf dem kapellenartigen Socken (ihrem Thron) ruht. Darunter liegt die
Phinthe in der abgescrägten Form der Hieroglyphe der Göttin
Maat. Davor stehen zwei Opferständer mit ihren Lotus-Stängeln.
Hatschepsut, über der ihre Kartusche mit ihrem Thronnamen Maat-ka-re
steht, opfert vorne ein Collier mit Falkenkopf-Verschlüssen (wsx)
dahinter mit ihrem Geburtsnamen
"Hatschepsut" in der Kartusche über ihrem Kopf, ein Tablett
mit den Hieroglyhen für Stoffe (mnx.t).
Ganz links ist ihre Ka-Standarte
mit dem Thronnamen in ungewöhnlicher Schreibung zu sehen. |
|
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- all rights reserved - |
Feindvernichtungsritual durch
die Gottesgemahlin
Einmalig bei den Darstellungen auf der Roten Kapelle
ist das "Feindvernichtungsritual", das von der Gottesgemahlin des
Amun durchgeführt wird. Sie erhält vom Gottesvater eine Fackel und vollzieht
ein magisches Verbrennungsritual an den knienden Gefangenen, deren Arme auf
den Rücken zusammengebunden sind - das Symbol des überwundenen Feindes
schlechthin.
Hier wird die Gottesgemahlin in einer
Rolle dargestellt, die ansonsten nur für den König selber vorbehalten ist.
Die Maat zu erhalten und die "Isfet" (Wort aus der ägyptischen
Mythologie - zu dt.: Unrecht oder Gewalt - siehe Jan Assmann, Ma'at /
Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, Beck'sche Reihe Band 1403
1990) zu vernichten war ein königliches Privileg - ähnlich wie die Symbolik
des "Erschlagen der Feinde". Die Identität der Gottesgemahlin ist
nicht geklärt - Hatschepsut gab dieses Amt auf, als sie sich zum
"König" krönen ließ. Ihre Nachfolgerin war die Prinzessin
Neferura, die aber in ihrem 16-17 Jahr vermutlich schon starb. Eine namentlich
genannte Nachfolgerin in der Regierungszeit von Hatschepsut ist nicht bekannt.
|
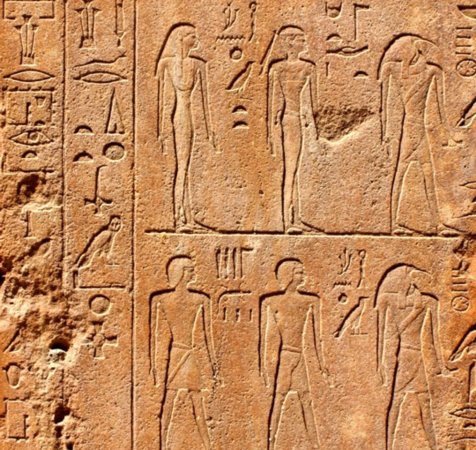
|
Sanktuar Nordwand 2. Register,
Block 147
Einzug der Gottesgemahlin/Gotteshand
Dieser Block und der danebenliegende
Block 37 gehören in der Szenenfolge zusammen. Links wird der Einzug der
Gottesgemahlin/Gotteshand in den Opferhof dargestellt. Die Prozession
wird jeweils angeführt vom Gott Thot, begleitet von einer
Henutet-Priesterin, Henutiu-Priestern mit den Dienern der
"Gottesgemahlin und Gotteshand"in den Tempelhof.
Links in der Beischrift steht:
"Ausziehen zum Opferhof. Vollziehen eines Brandopfers mit dem
[Feind] inmitten des Tempelvorhofes" und die Inschrift rechts
daneben lautet: "Sich aufstellen hinter ihm (= dem
Brandopferbecken). Feuer an das Brandopferbecken geben" (Quelle:
Grimm 1988 und 4).
|
|
Rote Kapelle Karnak - Sanktuar / Südwand
(Blöcke 164 + 48) |
| Hatschepsut opfert auf dem linken Block zwei
Gefäße mit Milch an Amun-Re (Block 164) - auf dem rechten Block ist
der Gott Amun-Re in seiner ithypallischen Gestalt zu sehen, die
ihn als Schöpfergott charakterisiert.
Die
merkwürdig aussehenden "Pflanzen" ? hinter Amun-Min (Block
48) scheinen Lattich-Pflanzen zu sein - die heilige Pflanze des Gottes
Min. Hinter dem Lattichbeet befindet sich eine Inschrift mit den
Worten von Amun-Min an Hatschepsut: "Ich habe dir gegeben, die
unendliche Jahre, indem du erschienen bist in der Königsherrschaft
über die Beiden Länder [wie] Re".
Die original rechts von ihm stehende Figur und Kartusche der
Hatschepsut wurde zerstört.
|
|
Bild: Courtesy Kairoinfo4U
- all rights reserved - |
Rote Kapelle Karnak - Sanktuar /
Südseite - 4., 6. und 7. Register |
| 7. Register: ganz oben an der Südwand des
Sanktuars sehen wir zwei zusammenhängende Böcke mit vier (links) und
drei und einem Götterkollegium eingehüllten Gottheiten. Die Blöcke
rechts und links davon fehlen. Lt. den erhaltenen Beischriften sehen
wir hier die "Große Götterneunheit von Karnak" - alle in
identischer Gestalt - nur ihre Namen unterscheiden sich. Den
Göttinnen fehlt der Götterbart und sie tragen eine dreigeteilte
Perücke.
Auf dem linken Block (129) kniet (zerstört) Hatschepsut und
opfert vor einem Gott und drei Göttinnen: von links nach rechts -
Renenutet, Tenenut und Junit.
Auf dem rechten Block (67) opfert ebenfalls Hatschepsut vor
einem Opfertisch vor dem Gott Ames (links), der Göttin Waset und
einem Götterkollegium.
6. Register: (links - Block 258) Hatschepsut (zerstört)
opfert zwei Gefässe Milch an eine Erscheinungsform des thronenden
Amun.
6. Register: (Block 70) Hatschepsut (teilweise zerstört)
opfert zwei Brote zu einer Erscheinungsform des Amun.
6. Register: (Block 271) Hatschepsut (zerstört) opfert
Wein zu einer Erscheinungsform des Amun.
5. Register: (Block 136) Die Barke des Amun -
aufgeständert auf dem "Großen Sitz" im Sanktuar der
Kapelle. Vor der Barke befindet sich eine lange Opferliste. Die beiden
Blöcke links und rechts der Barke sind nicht mehr vorhanden. |
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Rote Kapelle Karnak - Sanktuar / Nordseite (Block
259) |
| Auf dem Block 259 sind zwei Szenen zu sehen: links
führt Hatschepsut ein Libationsopfer vor dem ithypallischen Amun-Re,
König der Götter durch und auf der rechten Seite opfert sie
Weihrauch an Amun-Re in seiner ithypallischen Gestalt. |
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
In den ägyptischen Tempels werden normalerweise auch andere Götter
verehrt, die nicht unmittelbar dem Tempel angehören, sondern dort zu Gast
sind. In den kleinen Nebenkapellen, die um das Sanktuar herum gruppiert sind -
manchmal auch um das Allerheiligste herum, ruhen bei ihrer Anwesenheit ihre
Kultbilder, die bei den Festen herausgenommen werden und ebenfalls in
Prozessionen zu den Orten der Kulthandlungen gebracht werden. Auch die
Kultfiguren der königlichen Ahnen werden bei diesen Anlässen
mitgeführt.
|
Rote Kapelle / Sanktuar Nordseite/ 3. Register /
Block 140
- Begrüßung der Gastgötter - |
| Auf diesem Block sind die
Götterneunheit und die königlichen Ahnen (die verstorbenen
vergöttlichten Vor-Könige) zu sehen auf dem Weg ins Innere des Tempels, um
Amun die Ehre zu erweisen. In dieser Darstellung sind zwar die von den
Priestern getragenen Kultstatuen nicht vorhanden, dafür zeigt der
Hymnus links, ihre Bilder in Hieroglyphen.
Links im Bild ist die Gottesgemahlin des
Amun zu sehen, gefolgt von mehreren Priestern und Priesterinnen, hohen
Würdenträgern und das Volk (in 3 hieroglyphischen Zeichen als "rekhyt"
für alles Volk in der linken Kolumne geschrieben).
Der Beischrift der beiden beschädigten
Kolumnen zufolge wurde von den Untertanen ein Opfertisch vorbereitet.
Auf der rechten Seite des Blocks sind in zwei Registern weitere Noble,
Begleiter, Diener und Dienerinnen und das "gemeine Volk" (rekhyt)
in Gestalt von zwei Männern zu sehen, die beobachten, wie das
"(heilige Altar)-Feuer" herausgebracht wird.
(Text nach 4 und 2). |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Schon im Mittleren Reich ehrten die Könige von
Ägypten den Reichsgott Amun-Re, der aus einer Verschmelzung des Lokalgottes
von Waset (Theben), dem Gott Amun mit dem Sonnengott Re von Iunu (Heliopolis)
entstanden ist, mit der Errichtung eines Denkmals, das aus einem einzigen
Stück Granit bestanden hatte und eine beträchtliche Höhe erreichte. In der
frühen 18. Dynastie wurden 12 solcher Obelisken im Tempel von Karnak
aufgestellt, von denen zwei noch an ihrem originalen Platz erhalten sind.
Thutmosis I, der Vater von Hatschepsut und
Thutmosis II. war der erste Könige im Neuen Reich, der als Ehrerbietung für
den Götterkönig Amun-Re ein Obeliskenpaar anlässlich seines
Regierungsjubiläums (das zur Erneuerung der göttlichen Kraft des Königs
diente und allgemein nach 30jähriger Regierungszeit gefeiert wurde - wobei
allerdings gesagt werden muss, dass Thutmosis I. nur etwas mehr als ca. 9.
Jahre regierte) errichten ließ. Allgemein wird bislang angenommen, dass
Thutmosis I. die beiden Monolithen aus Rosengranit, die jeweils etwa 143 t
wogen, im Tempelhof zwischen dem 3. und 4. Pylon aufstellen ließ - von denen einer (19,5 m hoch) heute noch aufrecht steht.
|
Der einzige heute noch aufrecht stehende Obelisk
im Hof zwischen dem 3. und 4. Pylon
von Thutmosis I. (Höhe ca. 21,75 - nach Habachi 19,5 m, Gewicht
ungefähr 143 t). |
| Der Obelisk von Thutmosis I. steht noch
immer stabil im Hof zwischen dem 3. und 4. Pylon - obwohl er jetzt
etwas schief steht. Der Sockel des "Zwillings" ist noch
vorhanden, und einige Fragmente des 2. Obelisken liegen auf dem Boden
um den Sockel herum. Es ist bekannt, dass dieser "verlorene"
Obelisk im 18. Jahrhundert noch stand, da ihn der englische Reisende
Richard Pococke gezeichnet hat.
Auf allen 4 Seiten des Schaftes war eine vertikale,
gleichlautende Textkolumne angebracht, die mit dem Horusnamen des
Königs begann und lautete: dass Thutmosis I. ihn "als Denkmal
für seinen Vater Amun-Re, den Ersten der beiden Länder, errichten
ließ und für ihn am Doppeltor des Tempels zwei große Obelisken
errichtete, deren Pyramidion aus [Elektron] bestanden....."
Das Elektron ist heute vollkommen verschwunden.
König Ramses IV fügte etwa 400 Jahre nach der Aufstellung
dieser Obelisken links und rechts der Inschriftenkolumne von Thutmosis
I. eine weitere Kolumne mit seinem Namen hinzu, die ihrerseits dann
von Ramses VI. usurpiert wurde, indem er seinen Namen über die von
Ramses IV. setzen ließ. |
Bild: Obelisk
of Thutmose I.
Autor: Jorge Láscar from Melboume, Australia, Wikipedia
2014
Lizenz: CC
BY 2.0 Deed |
Vom "Zwilling" des Obelisken Thutmosis
I. ist heute an seinem ursprünglichen Standort nichts mehr zu sehen. Er ist
bei dem Versuch, ihn abzutragen in viele kleine Fragmente zersprungen. Lt.
Habachi (die unsterblichen Obelisken Ägyptens, S. 88, Mainz 1982) lagen in
der Nähe seines Sockels (der wohl bei dem Besuch Habachis noch zu sehen war
(?) auf dem Boden Bruchstücke herum.
|
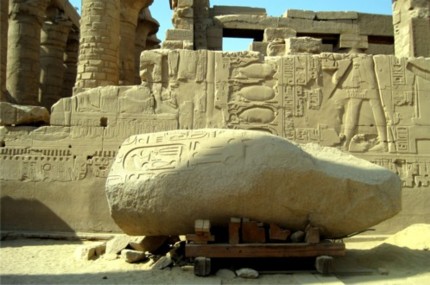
|
Bruchstück
des zerstörten Obelisken
von Thutmosis I. vor dem Nordturm
des 3. Pylons. Bild:
Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Der englische Reisende Richard Pococke hat den 2.
Obelisken von Thutmosis I. noch aufrecht
stehend gesehen. Einige der Bruchstücke befinden sich heute in den diversen
Steinlagern von Karnak - die Kartusche von Thutmosis I., ist auf diesen
Bruchstücken noch zu entziffern, so dass diese eindeutig Thutmosis I.
zugeordnet werden können.
In seinen Grabinschriften berichtet der
königliche Beamte Ineni/Anena (Grab Nr. 81) über das Obeliskenpaar im Hof
zwischen dem 3. und 4. Pylon: "Ich erlegte die Errichtung zweier großer
Obelisken.....ich erlegte das Zimmern des herrlichen Schiffes von 120 Ellen
Länge und 40 Ellen Breite, um die Obelisken zu transportieren, die in
Freieden und unversehrt ankamen und in Karnak an Land gebracht
wurden".
Es ist aber hier nicht schriftlich festgehalten
worden, dass Ineni auch noch erlebte, wie diese Obelisken aufgerichtet wurden,
so dass Ineni keiner Quelle dafür ist, dass diese noch unter Thutmosis I.
aufgestellt wurden.
Auch sein Sohn und Nachfolger Thutmosis II.
beauftragte seine Architekten damit, zwei Obelisken als Ehrerbietung für den
Reichsgott und Götterkönig Amun-Re in den Steinbrüchen von Assuan schlagen
zu lassen. Allerdings kam er während seiner (mutmaßlichen) kurzen
Regierungszeit nicht mehr dazu, diese im Karnak-Tempel aufstellen zu lassen.
Dieses geschah erst unter Hatschepsut. Sie ließ diese Obelisken, die nach
ihrer Verschiffung aus Assuan nach dem Tod von Thutmosis II. vermutlich
"irgendwo in den Magazinen des Karnak-Tempels zwischengelagert worden
waren" (siehe Larché, Cahiers de Karnak XIII. 2010) vor dem heutigen 4.
Pylon aufstellen. Vom Obeliskenpaar von Thutmosis II. sind heute nur noch
wenige Bruchstücke vorhanden, welche zum Teil nördlich der Hypostylhalle
gelagert wurden. Nach diesen Teilen mit fragmentarisch erhaltenen Inschriften
sowie Namenskartuschen des Königs, lässt sich belegen, dass diese Obelisken
Thutmosis II./errichtet unter Hatschepsut zuzuordnen sind. (siehe Gabolde, A
propos de deux obelisques de Thoutmosis II., Cahiers de Karnak 9, 1985).
Später ließ auch ihr Nachfolger Thutmosis III. während
seiner Alleinherrschaft westlich davon ein eigenes Obeliskenpaar errichten
(der damalige Standort war dort, wo heute der 3. Pylon steht). Die beiden
Sockel dieser Obelisken kamen in jüngster Zeit bei einer Ausgrabung unter den
Fundamenten des 3. Pylons zum Vorschein (siehe weiter unten - Grabung Larché).
Unter Amenophis III. erfolgten die letzten
Umbauarbeiten in diesem Bereich in der 18. Dynastie. Er ließ den jetzigen II.
Hof nach hinten versetzen und einen kleinen Vorgängerpylon sowie die
Westseite des Peristylhofes von Thutmosis IV. abreißen. Des weiteren wurden
die beiden Obelisken von Thutmosis II./Hatschepsut abgebaut, wobei diese in
mehrere Bruchstücke zerbrachen. Ebenso ließ er die Obelisken von Thutmosis
III. entfernen, um Platz für seinen heutigen 3. Pylon zu schaffen. Die Basen
der Obelisken ließ er stehen und verbaute beide in seinem neu errichteten 3.
Pylon. Ob die Obelisken dann dabei ebenfalls zerbrachen, kann heute nicht mehr
genau geklärt werden.
Im Bereich des Hofes zwischen 4. und 3. Pylon und
im 3. Pylon fand man Fragmente von Obelisken Thutmosis II./Hatschepsut und
Thutmosis III., die keinerlei Spuren (Aushackungen des Amun) aus der
Amarna-Zeit zeigten, was beweißt, das sie in der Amarnazeit nicht mehr
zugänglich gewesen sind. Während das westliche Obeliskenpaar auf jeden Fall
dem Bau des 3. Pylons weichen musste, in dessen Türme man die entsprechenden
Basen des Obeliskenpaares fand, geht man davon aus, dass auch das mittlere
Obeliskenpaar vor der Amarnazeit abgebaut worden sein muss (evtl. unter
Amenophis III. ?), wobei sie dann evtl. zersprungen waren. Wo diese Fragmente
dann in der Amarnazeit geblieben sind, kann heute nicht mehr ermittelt
werden. Lt. Larché wurden diese Fragmente noch vor der Amarnazeit
im 1. Hof vor dem 2. Pylon vergraben (Larché, F.: Cahiers de Karnak 13, Cairo
2010 - was aber wohl nicht stimmen kann, denn warum tragen diese Fragmente die
Kartuschen von Ramses II. und Merenptah, die beide ja erst nach der Amarnazeit
über Ägypten regierten?).Die Fragmente, welche man den beiden Obelisken von
Thutmosis III. zuordnete, zeigen Überarbeitungen von Ramses II. Dieser ließ
dieses Paar wohl für sich usurpieren und wollte sie neu aufrichten, evtl. auf
den Basen des mittleren Paares. Sein Sohn Merenptah vollendete dann evtl.
dieses Projekt oder ließ auch nur seine Kartuschen anbringen.
Im 1. Hof des Karnaktempels befand sich bis vor
einigen Jahren auf der Ostseite vor dem II. Pylon (Nordturm) ein kleines
"Steinlager", wo mehrere Obeliskenfragmente gelagert wurden (dieses
Steinlager ist heute allerdings nicht mehr vorhanden). Ein Obeliskenfragment -
gefunden im 1. Hof/ Nordseite vor dem II. Pylon - trug die Kartuschen mit dem
Thronnamen von König Merenptah. Ein weiteres Fragment, das davor platziert
war, könnte evtl. von dem gleichen Obelisk stammen und ist mit den Kartuschen
von Thutmosis III. beschriftet.
|
Fragmente von einem Obelisken Thutmosis III.
- bis vor einigen Jahren im 1. Hof des Karnaktempels, Nordseite - vor
dem II. Pylon - gelagert - |
| Vor der Ostseite des II.
Pylons von Karnak befand sich bis vor einigen Jahren ein kleines
Steinlager, wo mehrere Obeliskenfragmente zu sehen waren. Eines davon
trug (hintere Teil) die Kartuschen von Merenptah, während das vordere
Teil (der Rest einer Obeliskenspitze) mit den Kartuschen von Thutmosis
III. beschriftet war und an der Spitze eine Szene mit dem König und
dem thronenden Amun-Re (nicht in der Amarna-Zeit gelöscht - wenn sie
nicht in späterer Zeit neu eingeschlagen/restauriert wurde) und ganz
oben darüber eine weitere Darstellung des Amun-Re. |
|
Bild: Mit freundlichem Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Fr. Larche (the chapel of Amenhotep II. embedded
between the obelisks of Thutmosis I./Karnak 13, 2010, p. 297-326)
beschäftigte sich in seinem Werk mit der Frage, "warum der Obelisk von
Thutmosis III. in Karnak in der verschiedenen Literatur im Hof zwischen dem 3.
und 4. Pylon oft an verschiedenen Stellen platziert wurde. Er bestätigte die
Annahme, dass ehemals 3 Obeliskenpaare westlich des 4. Pylons aufgestellt
waren. Heute steht vom östlichsten Paar nur noch der südliche der beiden in
situ und trägt den Namen von Thutmosis I. - somit ist also die Zuordnung so
gut wie gesichert. Im Bereich des Hofes zwischen dem 4. und 3. Pylon und auch
im 3. Pylon fanden sich Fragmente von Obelisken Thutmosis II./Hatschepsut und
Thutmosis III., wodurch die beiden fehlenden Paare diesen Königen zuzuweisen
sind. Strittig ist hierbei nur die Reihenfolge ihrer Aufstellung.
Die neuesten Forschungsergebnisse des CFEETK belegen
bei der
Untersuchung aller drei Obeliskenpaare aber nun, "dass die vier östlichen
Obelisken (Thutmosis I. und Thutmosis II./Hatschepsut) auf je einem gemeinsamen Fundament errichtet wurden (siehe Larche, Cahiers de Karnak XIII, 2010). Die weiter westlich davon
errichteten Obelisken von Thutmosis III. standen dagegen auf
eigenen Fundamenten. Larché grub bei seinen Untersuchungen bis zum untersten
Fundament, wobei er entdeckte, dass die beiden östlichen Obeliskenpaare auf
einem gemeinsamen Fundament errichtet wurden. Hierbei entdeckte er am unteren
gemeinsamen Fundament mehrere Kartuschen mit dem Thronnamen von Hatschepsut (Maat-ka-ra),
was dafür sprechen würde, dass sowohl Thutmosis I. als auch sein Sohn
Thutmosis II. ihre Obelisken zwar noch geplant und evtl. auch noch lt. der
Biografie von Ineni (im Falle der beiden Obelisken von Thutmosis I.) nach
Karnak transportieren ließ - aber es nicht mehr zur Aufstellung kam.
So ergaben die Untersuchungen der Steinlagen bei den
beiden Fundamentpaare, auf denen die Sockel der Obelisken von Thutmosis I. und
II. standen, dass diese wohl gemeinsam evtl. erst unter Hatschepsut errichtet worden sein müssen. So
müsste die Zuweisung der Aufstellungssorte (von Ost nach West) lauten:
|
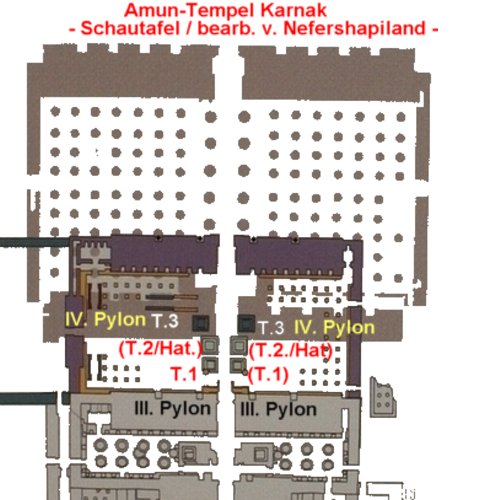
|
- Thutmosis I.
- Thutmosis II./Hatschepsut
- Thutmosis III. (musste später dem Bau des III.
Pylon weichen).
Während der Umbauarbeiten von Amenophis
III. musste das westliche Obeliskenpaar dem Bau des 3. Pylons weichen.
Die Basen bleiben stehen und wurden den den neuen Pylon verbaut. Es
kann nicht mehr geklärt werden, ob die Obelisken schon dabei
zerbrachen oder erst später.
Die beiden Obelisken von Thutmosis
II./Hatschepsut wurden wohl ebenfalls abgebaut, wobei diese wohl in
mehrere Bruchstücke zerfielen.
Nur noch der linke Obelisk von Thutmosis
I. steht heute noch in situ auf seinem Platz. Der Sockel seines
"Zwillings" ist noch vorhanden und einige Fragmente seines
Schaftes lagen/liegen (?) auf dem Boden um den Sockel herum.
Ein Teil der Fragmente des Obeliskenpaares
von Thutmosis II./Hatschepsut wurden später wiederverwendet, wovon
sich Bruchstück z. B. außen an der Süd-Westecke des Barkenschreines
von Phillipp Arrhidaios befindet. |
Nach Habachi (die unsterblichen Obelisken,
Ägyptens, 1982) ist die Abfolge noch (von West nach Ost) Thutmosis II.
Thutmosis III. und Thutmosis I. Aber Habachi kannte damals noch nicht die
Ergebnisse der Ausgrabungen von Larché).
F. Larché, (Cahiers de Karnak 13, Cairo 2010) vermutet daher, dass:
- unter der Regierung von Thutmosis I. zwei
Obelisken in Assuan geschlagen wurden, die dann mit dem Schiff nach Karnak
transportiert wurden - man aber aufgrund des Todes von
Thutmosis I. nicht mehr dazu kam, diese im Karnak-Tempel aufzustellen,
- und dass dann Hatschepsut, die wohl im
Karnak-Tempel zwischengelagerten Obelisken, auf zwei lange, parallel
angeordnete Fundamente vor dem 4. Pylon aufstellen lassen hatte. Die
Obelisken ihres Vaters Thutmosis I. ließ sie auf der Ostseite aufstellen
und auf der Westseite zwei weitere Obelisken, die sie mit dem Thronnamen
ihres Halb-Bruders und Gemahls Thutmosis II. dekorieren ließ.
Larche (2010) vermutet weiterhin, dass es
"wahrscheinlich diese beiden Obeliskenpaare waren, die später unter
Hatschepsut auf der Wand des Südflügels des 1. Portikus von Djeser Djeseru
(Totentempel Hatschepsuts) in Deir el Bahari dargestellt sind, und dass
Thutmosis III. bei der späteren Verfolgung ihrer Denkmäler ihren Thronnamen
auf den Obelisken von Thutmosis II./Hatschepsut durch den Namen seines Vaters
hat ersetzen lassen".
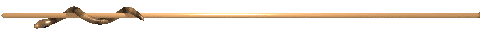
Insgesamt hat Hatschepsut dem Gott
Amun-Re vier Obelisken geweiht: Ihr erstes eigenes Obeliskenpaar ließ
Hatschepsut an der Ostseite des Amun-Tempels aufstellen. Heute sind an ihrem
ursprünglichen Aufstellungsort nur noch Teile der zerstörten und
unbeschrifteten Basen und der Fundamente vorhanden.
Vor dem (alten)
Nationalmuseum in Kairo befindet sich das erhalten gebliebene 3 m hohe
Pyramidion des einen Obelisken (entdeckt 1861 von Boulaq, der sie 1885 nach
Kairo bringen ließ) - wo dieses heute im Garten vor dem Eingang des alten
Ägyptischen Museums in Kairo ausgestellt ist. Trümmer
des 2. (südlichen) Pyramidions (Spitze) mit teilweise erhaltener Dekoration
auf drei Seiten, befinden sich in einem der Steinlager in Karnak (Quelle: www.maat-ka-ra.de). Weitere
Fragmente des "Zwillings" befinden sich heute im Gelände zwischen
dem Gegentempel und dem sog. Obelisken-Tempel und warten dort auf ihre
Restaurierung, da sie bereits durchnummeriert wurden (Stand 1016).
 |
Pyramidion des 1. Obeliskenpaares
im Garten des (alten) Ägyptischen Museums in Kairo
Die erhaltene Spitze (Pyramidion) eines Obelisken der
Hatschepsut gehörte zu einem der beiden zerstörten Obelisken, die
Hatschepsut zu ihrer Krönung hat an der Ostseite des Amun-Tempels
aufrichten lassen. Die Zuweisung zu den ersten Obelisken der Königin
beruht auf Angaben auf der Basis der beiden anderen Obelisken
zwischen dem 4. und 5. Pylon, welche ihre Aufstellung in das Jahr 16
datieren.
Die beiden ersten Obelisken wurden beim Bau der neuen
Umfassungsmauer um den Zentralbezirk von Karnak in die Mauer mit
einbezogen.
Das Pyramidion zeigte ursprünglich die Krönung
Hatschepsuts durch den Gott Amun-Re. Thutmosis III. ließ die Figur der
Königin ausmeißeln und durch zwei Opferständer ersetzen. Auch die
Figur des Gottes wurde geändert - anstatt der Krone, die er Hatschepsut
überreicht, hält er jetzt ein Szepter und ein Anchzeichen (siehe
Habachi 2000).
Bild: Egyptian
Museum - Pyramid in front
Autor: Daniel Mayer, Wikipedia
Lizenz: CC
- BY-SA 4.0
|
Dieses erste Obeliskenpaar wurde
bereits zur Krönung (nach ihrer Thronbesteigung) im Osten des Amun-Tempels in
Karnak aufgestellt. Sie erteilt ihrem Baumeister und Architekten Senenmut
(ihrem einflussreichsten und höchsten Beamten, der später unter Hatschepsut
zum "Obersten Vermögensverwalter" aufstieg) den Auftrag, zwei
Obelisken aus den Steinbrüchen von Assuan schlagen zu lassen und diese nach
Karnak transportieren zu lassen. Dieses ist durch eine von Senenmut stammende
Felsinschrift auf der Insel Sehel belegt. Zur Zeit der Beauftragung der beiden
ersten Obelisken und ihrer Aufstellung trug Hatschepsut noch die Titel
"Große Königliche Gemahlin, Königstochter, Königsschwester,
Gottesgemahlin Hatschepsut (mit Kartusche) - geliebt von Satet, der Herrin von
Elephantine und von Chnum, dem Herrn des Katarakten-Gebietes", was
belegt, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch die Regentschaft für Thutmosis III.
ausübte. Weiter unten auf dem Obelisken nennt Senenmut aber den Titel
"Herrin der Beiden Länder" (was ein Königstitel war). Dieses
belegt, dass beide Obelisken gezielt für die Krönung und Thronbesteigung von
Hatschepsut geholt und errichtet wurde. In der Obeliskenhalle ihres
Totentempels in Deir el-Bahari (im 1. Portikus) befindet sich eine
ausführliche Darstellung vom Transport und von der Aufstellung der beiden
Obelisken in Karnak.
Die beiden Obelisken wurden ganz im
Osten, im äußersten Bereich des Karnaktempels aufgestellt und flankierten
einen von ihr erbauten Tempel - den späteren sog. "Gegentempel"
("Ohr des Gottes"), der sich östlich an die Tenenosmauer anlehnt -
und seinen Eingang im Osten hat. Heute stehen von den beiden Obelisken nur
noch winzige Stümpfe. Nach dem Tod von Hatschepsut ließ Thutmosis III. die
Figur der Königin auf dem Pyramidion entfernen und durch Opfertische ersetzen.
Auch die Darstellung des Amun-Re wurde geändert, er hält nun ein Szepter und
ein Anch-Zeichen, anstatt der Krone, die er ursprünglich an Hatschepsut
reicht (siehe Habache, 2000). Später wurde in der Amarnazeit die Darstellung
des Gottes zerstört und dann in ramessidischer Zeit wieder hergestellt - wie
die Restaurationsinschrift auf einem Blockrest belegt.
Das 2. Paar Obelisken Hatschepsuts
Unter Hatschepsut wurde die von ihrem Vater
Thutmosis I. erbaute Säulenhalle (Wadjet-Halle) zwischen dem 4. und 5. Pylon
umgebaut und sie ließ rechts und links des Durchganges, zu ihrem
Jubiläumnsfest (im Jahre 16) zwei weitere Obelisken aus Rosengranit
errichten. Einer der beiden Obelisken steht noch heute in situ und hat eine
Höhe von 28,48 m (ca. 30 m mit Sockel) und sein Gewicht beträgt ca. 323
Tonnen. An den Basen des noch aufrecht stehenden Obelisken befindet sich auf
allen 4 Seiten eine Inschrift, auf der die Entstehung der Obelisken
beschrieben wird.
Auf allen 4 Seiten des
Obelisken befinden sich vertikale Inschriften und Darstellungen der knienden
Königin, die Opfer an Amun-Re darbringt. Laut Inschrift waren die Spitzen der
Obelisken mit Elektron (ägypt.: "djam") vergoldet um mit
ihrem Leuchten die ersten Sonnenstrahlen des Re zu begrüssen.
Hieroglyphischer Text auf der Westseite des noch
stehenden Obelisken
".....Maat-ka-ra, sie machte (dies) als ihr Denkmal für
ihren Vater Amun, den Herrn der Throne der beiden Länder, dass für
ihn die beiden großen Obelisken an dem prächtigen Tor (= Pylon) (mit
Namen) "Das Ansehen des Amun ist groß" aufgestellt werden,
die mit sehr viel Elektrum beschlagen waren und die Beiden Länder wie
die Sonne erleuchten. Niemals war dergleichen seit Urzeit der Erde
geschehen. Es machte ihm (= Amum) der "Sohn des Ra
"Hatschepsut, vereinigt mit Amun", dem Leben gegeben werde
wie Ra, ewiglich".
(Übersetzung des hieroglyphischen Textes von Sethe (1927/1930) durch
E. Blumenthal, I. Müller, W. F. Reinike / 1984). |
Der Haushofmeister Amen-hotep der Königin führte die
Aufsicht über das Unternehmen der Beschaffung und des Transportes der beiden
Obelisken, die aus dem Steinbruch auf der Insel Sehel bei Assuan aus dem
Granit geschnitten wurden. Unter der Verantwortung des Vorstehers des
Schatzhauses, Djehuti, wurden die Obelisken aufgerichtet und die obere Spitze
mit Elektrum verkleidet (wie auf der Northampton-Stele berichtet wird).
Auf einem Reliefblock der Roten Kapelle Hatschepsuts
wird von dem Transport und dem Aufstellen zweier Obelisken berichtet. Im Text
ist auch der Aufstellungsort genannt, woraus ersichtlich ist, dass es sich
hier um das zweite Paar Obelisken handelt, welches zum "heb-sed-Fest"
der Königin in der Festhalle Thutmosis I. (zwischen 4. und 5. Pylon)
gestiftet wurde.
König Thutmosis III. ließ um den unteren Teil des
noch aufrechtstehenden Obelisken eine Mauer errichten, die sehr lange Zeit
bestanden haben muss, was am Grad der Verwitterung und der Verfärbung des
Obeliskenschaftes zu sehen ist. An der Nordseite des noch stehenden Obelisken
wurde der Thronname der Königin ausgelöscht - während sich an der Nordseite
oben der Horusname Hatschepsuts erhalten hat. Auch ihre Namen auf den anderen
Seiten des Obelisken wurden nicht ausgelöscht.
|
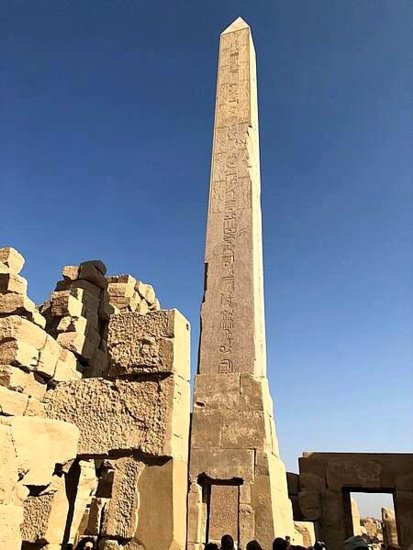
|
Der heute noch aufrecht stehender nördliche Obelisk
Hatschepsuts
- im Karnak-Tempel (Obelisk E)
Thutmosis I. ließ zwischen dem 4. und 5. Pylon eine
Säulenhalle errichten, die Hatschepsut in ihrer Regierungszeit umbauen
ließ und rechts und links des Durchgangs zu ihrem Jubiläumsfest
("heb-sed-Fest") im Jahr 16 ein zweites Paar Obelisken aus
Rosengranit aufstellen ließ.
Der heute noch stehende Obelisk hat eine Höhe von
28,48m und ein Gewicht von 323 t). An der etwas dunkleren Färbung im
unteren Teil ist zu erkennen, bis zu welcher Höhe der Obelisk später
durch die Umbaumaßnahmen Thutmosis III. ummantelt wurde - und damit
unbeabsichtigt vor der Ausbleichung durch die Sonne geschützt war.
|
Bild:
Karnak,
ancienne cité de Theben, Obelisk d'Hatshepsut
Autor: Marie Therése Hébert & Jean Robert Thibault,
Quebec
Lizenz: CC-BY-SA
2.0 |
Der
gefallene
Obelisk der Hatschepsut:
Der südliche der beiden
Obelisken (Obelisk F) stürzte bereits in der Antike um und ist zerbrochen -
evtl. bei einem Erdbeben? Der genaue Zeitpunkt ist heute unbekannt. Nur sein
Sockel hat sich an Ort und Stelle erhalten sowie drei Fragmente von ihm. Der
obere Teil lag bis vor kurzem auf Betonblöcken in der Nähe des Heiligen
Sees.
|
Der noch bis April 2022 am Heiligen See liegende
Teil des 2. Obelisken |
|
Bild: Courtesy to Monika Jennrich
- alle Rechte vorbehalten - |
Auf seinem noch vorhandenen Sockel - zwischen 4. und 5. Pylon - befinden
sich heute Fragmente des unteren Teiles des Obelisken mit einer Höhe von 2 m.
Zusammen mit seinem Pyramidion am Heiligen See und weiteren Fragmenten, die
sich heute in Boston, Liverpool, Glasgow und Sydney befinden, sind ca. 30 %
des Obelisken erhalten. Im April 2022
wurde dieser obere Teil des Obelisken (Obelisk F / noch 11m hoch) von einem
Team aus Archäologen, Restauratoren und Ingenieuren im Auftrag des Obersten
Rates für Altertümer (Supreme Council of Antiquities) im Tempel von Karnak
in der Nähe des Heiligen Sees wieder aufgestellt. Der heutige neue Standort
am Heiligen See ist aber nicht der ursprüngliche Standort des Obelisken,
dieser befindet sich zwischen dem 4. und 5. Pylon.
|

|
der restaurierte und
neu-aufgerichtete Obelisk am See
Laut dem
Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, Mostafa Waziri,
hätten Untersuchungen ergeben, "dass der Obelisk an seiner
bisherigen Stelle gefährdet war und deshalb restauriert und verlegt
werden musste". Es wurde nicht gesagt, worin die
"Gefährdung" bestand (Quelle: Selket's Ägypten-Blog).
Gesichert und liegend platziert wurde der gefallene Obelisk Anfang des
20. Jahrhunderts durch den französischen Ägyptologen Georges Legrain,
der zu dieser Zeit Aufseher über die Wiederherstellungsarbeiten im
Karnaktempel war. Er ließ ihn auch liegend in der Nähe des Heiligen
Sees platzieren.
Der neu erschaffene
Sockel soll noch verschönert werden.
Bild: Courtesy to
Saamunra 2022
- alle Rechte vorbehalten - |
An der Spitze des Obelisken ist der auf seinem Thron sitzende
Gott Amun-Re und seine "Tochter Maat-ka-ra" zu sehen, die in
männlicher Darstellung vor dem Gott kniet. Ihr Thronname Maat-ka-ra ist links
oben in einer Kartusche zu sehen.
Fragmente des unteren Teils des gefallenen Obelisken sind auf der
Südseite des noch stehenden Obelisken Hatschepsut verblieben, ebenfalls der
Sockel. Lt. Labib Habachi ("The Obelisk of Egypt, 1977)" kann es
sein, dass der Obelisk irgendwann in kleinere Stücke zerbrochen ist und
andere Fragmente dieses Obelisken sind weit gereist, nach Boston, Liverpool,
Glasgow und Sydney.
|

|
Fragment des gefallenen Obelisken Hatschepsuts
- mit seinem Sockel -
Oben auf dem, Fragment des umgestürzten Obelisken
sind auf der Ostseite 3 Obelisken eingezeichnet, ebenso wie auf dem noch
stehender Obelisk (Ostseite) nur 3 Obelisken eingezeichnet sind.
Tatsächlich wurden aber jeweils immer nur 2 Obelisken (als Paar)
aufgestellt.
Autor des Fotos: Courtesy to Kairoinfo4U
- Bild beschnitten von Nefershapiland - |
Umgestaltungen des Amun-Re Bezirkes im
Karnaktempel in der Regierungszeit von Hatschepsut
Während ihrer Regierungszeit als
Pharao hat Hatschepsut den von ihrem Vater erbauten Tempelbezirk sehr
umfangreich umgestalten lassen. Neben der Roten Kapelle wurde das aus dem
Beginn des Neuen Reiches stammende Zentrum der Tempelanlage von Karnak durch
ein Gebäudekomplex aus Magazinen und Opferräumen (auch als "Palast der
Maat oder Kammern der Hatschepsut" bekannt) erweitert, dass direkt
vor den Bauten aus dem Mittleren Reich errichtet wurde und aus Sandstein (auf
einer Grundfläche von 19 x 37 m stand) bestand.
Lt. einer Inschrift, die sich an der Außenwand der nördlichen
(linken) Räume) befindet, wurden diese im 17. Regierungsjahr der Königin
erbaut (oder fertig gestellt). Dieser Komplex ist lt. Ausgrabungsbericht des
CFEETK zusammen mit der Roten Kapelle auf einem eigenen Podium erbaut worden,
das aus drei Lagen großer Sandsteinblöcke errichtet wurde, was als
Folge davon bewirkte, dass die Oberfläche des Podiums deutlich höher als der
Boden des umliegenden Tempels lag und nur über Treppen zu erreichen war (2 +
3).
In der modernen Literatur wird die Bezeichnung
"Palast der Maat" für die nördlich und südlich vom zentralen
Barkensanktuar gelegenen Kammern der Hatschepsut und für die Rote Kapelle aus
der Zeit von Hatschepsut verwendet (bzw. dem unter Thutmosis III. erbauten
Ersatz). Lt. den Forschungen des CFEETK war die Rote Kapelle zwischen den
nördlichen und dem nördlichen und südlichen Gebäudekomplex des
Barkensanktuars platziert. Einige andere Autoren zählen allerdings die
"Rote Kapelle" nicht zum "Palast der Maat" (2).
Zum "Palast der Maat" siehe unter Bauten
Karnak/Thutmosis III. 
|
Die Kammern der Hatschepsut
(Palast der Maat) |
| Die obige Abbildung zeit die Anordnung der Kammern
der Hatschepsut - in der Mitte (in rot) die Rote Kapelle zur Zeit der
Hatschepsut. Die Nummerierung der Räume ist nach Porter & Moss
II. Theban Temples erfolgt. Die Räume 1-5 auf der Nordseite hat PM
nicht nummeriert. |
| Die südlichen Räume (rechte Seite) der Hatschepsut
sind heute für die Touristen nicht mehr zugänglich (vermutlich wegen
der engen Raumverhältnisse). Fotos sind beim Schwaller de Lubicz
(Tafel 165) etc. und beim Chicago Oriental Institute (Online-Version)
zu sehen. |
|
Umzeichnung: nach Lárche, Burgos - La Chapelle
Rouge 2008, unter Hatschepsut
modifiziert von Nefershapiland. |
Mitten im "Palast der Maat" aus der Zeit
von Hatschepsut, auf der Hauptachse des Amun-Tempels, ließ Thutmosis III.
später seinen eigenen Barkenschrein erbauen. Den Barkenschrein aus der Zeit
von Hatschepsut ließ er abreißen, um Platz für seinen eigenen Schrein zu
gewinnen. Philipp III. Arrhidaios (Halbbruder von Alexander den Großen) ließ
seinerseits den schon verfallenen Schrein von Thutmosis III. ebenfalls abbauen
und errichtete an der gleichen Stelle seinen eigenen aus Rosengranit (18 m
lang, 6 m breit mit 2 Räumen), der heute noch steht.
Auf der linken Seite des heutigen Barkensanktuars
von Philipp III. Arrhidaios führt ein Weg zum 2. Granittor, das ursprünglich
aus der Roten Kapelle von Hatschepsut stammte. Dort war es der Haupteingang -
nun führt es in einen kleinen Hof, in dem zwei Kapellen liegen. Die linke
Kapelle wurde für Thutmosis II. errichtet, die rechte für seine Gemahlin
Hatschepsut. Später wurden diese Kapellen von Thutmosis III. umgearbeitet.
|

|
Palast der Maat (PM² II 102
[299] )
Tor aus Granit nördlich des Sanktuars v.
Ph. Arrhidaeus
wiederverwendet vom Barkenschrein Hatschepsuts
einstmals das Osttor der Roten Kapelle
Das Tor, das einst das Osttor der
Roten Kapelle von Hatschepsut bildete, führt heute in die nördlichen
(linken) Räume des Komplexes (Palast der Maat) und von Thutmosis III.
wiederverwendet und dekoriert wurde. Auf dem äußeren Türsturz
befinden sich die königlichen Namen von Thutmosis III.
Hinter diesem Tor befindet sich (lt.
Porter & Moss ² II, 102 ff.) ein Vorraum, von dem man durch einen
weiteren Zugang in die Räume XII. und XIII. gelangt - sowie in die
kleinen Kammern 1-5, die sich auf der Westseite befinden. An den Wänden
des Vorraumes ist nur noch wenig von den Darstellungen (Thutmosis III.)
erhalten.
Alle Darstellungen der Hatschepsut und
auch die meisten ihrer Kartuschen sind zerstört - aber die
Darstellungen der Götter (auch die des Amun-Re) bleiben unbeschädigt,
da sie nach der Errichtung der Annalenwand unter Thutmosis III. in der
Amarnazeit - wo die Zerstörungen der meisten Götter unter Echnaton
durchgeführt wurden - nicht mehr sichtbar waren.
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- Fotograf: Francois Olivier - |
Nordkammern des
Palast der Maat
Die Nordwand des Raumes XII. (siehe Plan
oben) besitzt noch gut
erhaltene - teils farbige Reliefs - mit zwei Registern. Jedes der beiden
Register zeigt zwei Szenen. Im oberen Register (bei Porter & Moss Register
II.) führen in der östlichen Szene die Götter Atum und Month Hatschepsut
vor Amun-Re. In der mittleren Szene (siehe Bild unten) ist die Königin
(gefolgt von ihrem Ka) bei der Weihung von Opfergaben an den Gott Amun-Re zu
sehen. In der dritten Szene (auf der linken (westlichen Seite) steht sie mit
Opfergaben vor dem ithypallischen Gott Amun-Min.
Die Kammern der Hatschepsut
(Palast der Maat) (PM² II 103 [302. I. - Register]
Raum XII - nördliche Seite des Palastes der Maat
- Relief auf der linken Wand - obere Register (PM 302 - siehe Plan
oben) |
| Dritte Szene im oberen Register: Hatschepsut
(rechts ausgelöscht) weiht Opfergaben vor Amun - gefolgt von ihrem
Ka. |
|
Bild: Courtesy to Peter Alscher
- alle Rechte vorbehalten - |
Auch im unteren Register befinden sich drei Szenen
(PM Register II.). Diese Darstellungen wurden ursprünglich von Teilen der
Annalen-Wand Thutmosis III. verdeckt und waren daher in der Amarna-Zeit
"unsichtbar". Der linke Teil der Szenen ist heute kaum noch zu
erkennen. Nach PM ² 102 (302) opfert Hatschepsut ganz links (nicht im Bild)
vor Amun-Re - ihr Ka steht hinter ihr. Nach rechts ist die ausgehackte Figur
der Königin in einer Laufszene (Rituallauf) mit je einer "hs.t"-Vase
in jeder Hand zu sehen für eine "Wasserspende" für den
ithypallischen Gott Amun. Auch die Kartuschen sind teilweise zerstört. In der
rechten Szene - diese Szene ist Bestandteil jeder Karnakführung durch die
Reiseleiter - (siehe Bild unten) wird Hatschepsut (Figur ausgemerzt) von Thot
(rechts) und Horus (links) gereinigt und mit "anch"-Zeichen (ewiges
Leben) übergossen.
Die Kammern der Hatschepsut
(Palast der Maat) (PM² II 203 [102/ II. Register]
Raum XII - nördliche Seite des Palastes der Maat
- Relief auf der linken Wand (PM 302) |
| In der Mitte stand original die Königin
Hatschepsut, die von Thot (rechts) und Horus von Edfu (links)
gereinigt und mit "anch"-Zeichen übergossen wird. Die Figur
der Hatschepsut wurde unter der Regierung von Thutmosis III.
ausgehackt und ihre Kartuschen teilweise zerstört. |
|
Bild: Courtesy to Peter Alscher
- alle Rechte vorbehalten -
Bildränder beschnitten von Nefershapiland |
Die Südwand (Raum XII) (PM² II 102
[299] ) befindet sich heute immer noch an ihrem ursprünglichen Platz.
Auch sie zeigt Darstellungen der Hatschepsut (siehe Plan oben) - wobei die
Figur der Hatschepsut wiederum zerstört wurde. Danach wurden diese Teile der
Wand neu dekoriert. Auch die Götterdarstellungen sind zerstört, da sie in
der Amarnazeit zugänglich waren (danach ebenfalls wieder restauriert. Lt. PM,
Register I. (oben) steht die Königin (geändert auf Thutmosis II. und III.)
in zwei Szenen vor dem ithypallischen Gott Amun (in der Mitte), sowie in der
linken (dritten) Szene - wiederum auf Thutmosis II. geändert) mit einer
Gabenliste vor dem Gott Amun. Ganz oben an der Wand befindet sich ein Fries
mit dem Kryptogramm der Königin über der Opferliste - was die Zuweisung
dieses Raumes an Hatschepsut belegt.
Die nördlichen kleinen Kammern 1-5 sind
stark zerstört und die Mauern sind heute meist nur bis zu einer Höhe von ca.
1 m erhalten, wobei die Dekoration der Wände fast vollständig zerstört ist.
Auf der Nordwand der Außenseite der nördlichen Kammern
befindet sich der Rest einer Inschrift der Hatschepsut mit der Angabe, dass
diese Räume im Jahre 17 der Hatschepsut errichtet wurden. Dieser Teil der
Inschrift hat sich einst über die gesamte Außenseite nach Osten fortgesetzt
und blieb nur erhalten durch die Errichtung eines Tores unter Thutmosis III,
wobei der westliche Türpfosten die Inschrift überdeckte - der restliche Teil
der Wand wurde neu geglättet aber wohl nicht mehr mit einer Dekoration neu
verkleidet (Quelle: www.maat-ka-ra.de)
Südliche Kammern des Palast
der Maat
Die südlichen Räume des Palastes
der Maat sind für den normalen Touristen heute gesperrt (oder nur mit einer
Sondergenehmigung zugänglich - wohl aufgrund der engen Raumverhältnisse),
deshalb gibt es auch kaum Fotos davon (außer einigen beim Chicago Institute
online oder einige wenige bei Schwaller de Lubicz - Tafel 165). Auf der
Nordwand des Umgangs zwischen dem Barkenschrein und der nördlichen Wand der
Kammern befinden sich am oberen Rand noch einige schlecht sichtbare
Dekorationsreste aus der gemeinsamen Regierungszeit von Hatschepsut/Thutmosis
III. Zu sehen sind (bei guten Lichtverhältnissen) einige Opfergaben und eine
Reihe von Opferträgern (2).
Das Eingangstor zu den südlichen Kammern
(PM² II. 104 [313] ) liegt am Ostende des Umgangs und ist mit dem Namen
Thutmosis III. beschriftet. An der Basis des linken Türpfostens befindet sich
der Name des Tores: "Geliebter des Amun-Re wegen [der Größe] seiner
Denkmäler" (nach Urk. IV. 851.8) und ein Erneuerungstext von Sethos I.
an der Basis. Die Wände des Raumes XVI (in der Nord-Ost-Ecke) sind sehr stark
zerstört und die Dekoration ist nur noch sporadisch erhalten und mit einer
Einigungsszene mit Thutmosis III. dekoriert. Ebenso auf der Südwand (PM
314b), wo Thutmosis von Thot und Horus zu Amun geführt wird.
Im Raum XIX befinden sich auf der
Südseite die Überreste eines großen Rosengranit-Blocks (PM II 105 [322] ),
auf dessen Längsseite (Ost- und Westseite) sich Inschriften befinden. Über
die Bedeutung dieses Blocks wird unter den Ägyptologen gestritten. Einige
halten ihn für die Überreste eines Opferaltars, andere um einen
Schreinuntersatz. Mehrere Stufen führten auf der Nordseite auf die heute
zerstörte Plattform dieses Blocks. Links neben der obersten Treppenstufe ist
die Kartusche von Thutmosis III. erhalten geblieben. Dieser Raum ist von
Thutmosis III. für seinen Vater Thutmosis II. geweiht - ursprünglich standen
hier die die Kartuschen von Hatschepsut, welche später von Thutmosis III. in
die seines Vaters umgeschrieben wurden.
Auf der Nordwand von Raum XIX - neben dem
Tor zu Raum XVII (siehe Plan oben) befindet sich eine Darstellung der Königin
Hatschepsut (PM 321a) vor den Opfergaben für Amun-Re, der sich für die
Errichtung des Tempels bedankt und den Kartuschen von Thutmosis II. (die
Kartusche von Hatschepsut wurde später von Thutmosis III. für seinen Vater
usurpiert).
Auf der östlichen Wand des Raumes XIX
befinden sich die beiden Eingänge zu den oberen Räumen XX und XXI. Die
Kartuschen auf dem Türsturz der Kammer XIX in die Kammer XX wurden unter
Thutmosis III. überarbeitet (geglättet und nur noch sehr schwach sichtbar)
und in der oberen Reihe von "Maat-ka-Re" auf den Namen seines Vaters
Thutmosis II. (Aa-cheperu-n-Re) geändert und ebenfalls in der unteren Reihe
(leider gibt es bei Porter & Moss zu diesen Wänden und Durchgängen keine
Informationen (evtl. waren diese Wände damals noch nicht sichtbar oder erst
später restauriert (?).
Auf der nördlichen inneren Eingangwand
(PM 321c, Register II.) sind schwach die Reste einer Szene von Hatschepsut zu
erkennen (abgeändert in Thutmosis II.) die in einer Doppeldarstellung beim
Ritual "des Errichten von 4 Statuen von Dedwen von Nubien, Sopt von
Osten, Sobek von Libyen und Horus von Süden und Norden zu sehen ist (siehe
Barguet, Temple, S. 145).
Au der Südwand von Raum XXI befinden
sich ebenfalls drei Szenen (PM 324 schreibt Thutmosis III. libierend vor dem
schreitenden Amun) - in der Mitte bringt Hatschepsut - usurpiert von Thutmosis
III. auf seinen Vater Thutmosis II. (wobei die Kartuschen eindeutig Spuren von
Überarbeitungen zeigen) - Wein vor Amun-Kamutef dar.
Zum Raum XXII (in der Westecke der
Kammern der Maat) (PM² II 106 [325ff] - nach Barguet: Temple, S. 148 -
siehe  (Bauten Thutmosis III. in Karnak. (Ebenfalls mit Opferszenen
Hatschepsut).
(Bauten Thutmosis III. in Karnak. (Ebenfalls mit Opferszenen
Hatschepsut).
Umbauten Hatschepsuts in der
Wadjit-Halle
Den Säulensaal (Wadjit-Halle) ihres
Vaters Thutmosis I. zwischen dem 4. und dem 5. Pylon, ließ Hatschepsut so
umbauen, dass für sie ein zweites Obeliskenpaar aufgestellt werden konnte -
der Anlass dazu war wahrscheinlich ihr Thronjubiläum im 16. Regierungsjahr,
wovon nur noch der nördliche Obelisk heute steht. Hatschepsut behauptet lt.
Larché (New statues at Karnak, Egyptian Archaeology 16, 2000) in ihren
Inschriften, dass sie am ziemlich zerstörten 4. Pylon 4 sitzende, oside
Statuen aus Sandstein im Namen ihres Vaters Thutmosis I. hat errichten lassen.
1999 wurden bei Sanierungsarbeiten am ziemlich zerstörten 4. Pylon vier von
ursprünglich 8 Nischen entdeckt, in denen man noch 4 Unterteile dieser
Statuen fand (siehe Larché).
Thutmosis I. begann mit dem Bau der neuen
Halle, der in zwei Phasen ablief. Zuerst wurde in die Ostwand des 4. Pylons
eine Reihe rechteckiger Nischen eingefügt, in denen sitzende Statuen des
Königs in der Pose des Gottes Osiris aufgestellt wurden. In der 2. Phase
stellte man eine weitere Gruppe von Osiris-Statuen (Höhe 3,15m) entlang der
Wand zwischen den Nischen auf, die bemalt waren (wie anhand der noch
vorhandenen Spuren von blauer und schwarzer Farbe auf diesen Statuen zu
erkennen ist). Die Statuen auf der Nordseite trugen die Doppelkronen und die
auf der Südseite die weiße Krone. An den vier Seiten der Halle wurden
geriffelte Sandsteinsäulen mit Inschriften von Thutmosis I. angebracht,
welche einen überdachten Peristyl zum Schutz der Statuen bildeten.
|
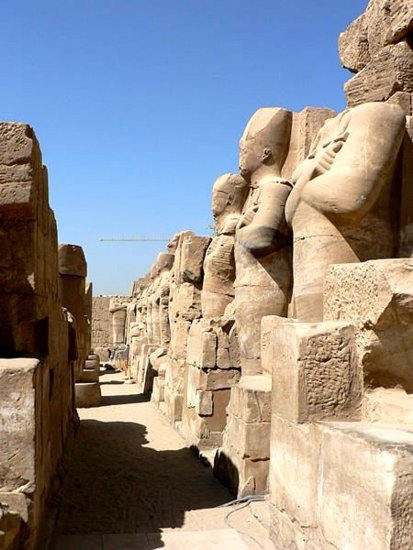
|
Wadjit-Halle - heutige Anischt
Heutige Ansicht von Norden her - die osiden Statuen
stammen von Thutmosis I.
Die Wadjit-Halle befand sich zwischen dem 4. und 5.
Pylon. Große, teils zerbrochene oside Sandsteinstatuen von Thutmosis I.
schmücken noch immer die rechteckige Halle (Maße: 75 m breit und 14 m
tief. |
Bild:
Karnak
Temple Luxor
Autor: eviljohnius, Wikipedia 9. Juni 2005
Lizenz: CC
BY-2.0 DEED
|
Hatschepsut ließ die Steinsäulen von
Thutmosis I. entfernen und durch fünf vergoldete papyrusförmige Wadj-Säulen
aus Holz ersetzen (daher der Name "Wadjet"/Papyrus für die Halle).
Eine Holzdecke überdachte den nördlichen und südlichen Bereich der Halle
und wurde von diesen Säulen getragen. Durch die beiden Obelisken im zentralen
Bereich, die entlang der Mittelachse der Halle zwischen dem 4. und 5. Pylon
aufgerichtet wurden, konnte die Wadjet-Halle aber nicht vollständig
überdacht werden. Die südliche
Hälfte der Halle war durch den Nischenanbau des 4. Pylons größer als die
nördliche Hälfte, was zur Folge hatte, dass in der südlichen Hälfte drei
und in der nördlichen Hälfte zwei der Säulen aufgebaut wurden.
Thutmosis III. ließ während seiner
Alleinherrschaft dann um die beiden Obelisken eine "Ummantelung" aus
Stein aufstellen (d. h., er ließ sie einmauern), wobei sie zugleich als
"Torbau" zu den dadurch entstandenen neuen Kammern dienten. Beide
Türen im Norden und Süden tragen Bauinschriften von Thutmosis III. (Quelle:
Silke Grallert, Bauen-Stiften-Weihen, Achet-Verlag Berlin 2001).
In der Armanazeit unter Echnaton
"scheute man offensichtlich keine Mühe", bis zur Obeliskenspitze
vorzudringen um die Elektronverkleidung zu entfernen und die Reliefs zu
zerstören.
Vorgängerbau an der Stelle des
Achmenu
Allgemein bekannt ist, dass sowohl
Hatschepsut als auch Thutmosis III. die Tempelanlage des Amun durch Umbauten
und Erweiterungen nach Westen vergrößerten. Aber was ist mit der Ostseite
bei den zentralen Kultbauten aus dem Mittleren Reich? Wir wissen, dass
Thutmosis III. sein "Ach-menu" dort erbauen ließ - aber gab es da
schon vorher irgendwelche Vorgängerbauten, die er abreißen ließ oder baute
Thutmosis dort auf "jungfräulichem" Gelände?
Wie Varille in ASAE 50 (Annales du Servie
des Antiquités de l'Egypt, Kairo) berichtet, fanden die Ausgräber in der
hinteren Lage des Fundaments - unter der Basis des südlichen Obelisken
verbaut - ein Architrav von Thutmosis II. (dem Ehemann Hatschepsuts) und einen
Block von Thutmosis III., die beide auf dem Kopf standen. Allerdings ist es
bis heute noch nicht geklärt, woher diese Blöcke stammen - evtl. hatte sie
Hatschepsut dort verbauen lassen oder sie stammen aus Restaurationsarbeiten.
In einer Publikation von Carlotti (L'Akh-menou de Toutmosis III á Karnak in
CFEETK, 2001 Paris) weisen einige Funde, die sekundär im Ach-menu oder in
benachbarten Gebäuden verbaut gefunden wurden, die evtl. Existenz eines
Vorgängerbaus an der Stelle des Ach-menus von Thutmosis oder in direkter
Nähe in. Man fand dort 5 Architrave (auf 2 davon standen die Kartuschen von
Hatschepsut) die als Bodenplatten im axialen Sanktuar verwendet wurden, des
weiteren ein Kalksteinblock - ebenfalls mit der Kartusche von Hatschepsut, ein
Block mit Hohlkehle und 2 Blöcke (wie schon oben erwähnt), ein Architrav mit
dem Namen von Thutmosis II. und ein Block mit den Kartuschen von Thutmosis
III. in der Basis des südlichen Ost-Obelisken der Hatschepsut.
Da normalerweise Obelisken vor dem
Eingang zu einem Tempel oder einem vergleichbaren Gebäude aufgestellt wurden
- das Ach-menu wie auch der Tempel aus dem Mittleren Reich die beide keinen
Eingang auf der Ostseite besaßen, ist zu vermuten, dass die Ost-Obelisken von
Hatschepsut bei ihrer Errichtung in Verbindung zu einem anderen Bauwerk erbaut
wurden, die östlich der Mittleren-Reich-Bauten an dieser Stelle gestanden
hatten und Thutmosis III. diese später beim Bau seines Ach-menus abreißen
ließ.
Auch auf einer Stele von Thutmosis III.,
die im Nordhof des 6. Pylons gefunden wurde, wird die Errichtung eines
Bauwerkes im Osten des Amun-Tempels erwähnt. Barguet will hier in dem Text
das Ach-menu Thutmosis III. wiedererkannt haben. Thutmosis III. berichtet in
seinem Text, dass ".....er sein Monument auf einem Boden einrichten
ließ, der mit Sandsteinblöcken erhöht wurde (um vor Überschwemmungen
geschützt zu sein).......", weiter teilt Thutmosis uns mit, dass er
"....kein Monument eines anderen Herrschers zerstört hätte, um seines
zu bauen". Dieses lässt vermuten, dass das Ach-menu auf einem Boden
errichtet worden ist, wo es unmittelbar keine Vorgängerbauten eines anderen
Königs gab, aber natürlich besteht die Möglichkeit, dass in der direkten
Umgebung andere Bauten standen (evtl. Überreste eines Gebäudes aus der
gemeinsamen Regierungszeit von Hatschepsut/Thutmosis III., worauf die wenigen
Blöcke hinweisen, die im Ach-menu und im Fundament der östlichen Obelisken
Hatschepsuts gefunden wiederverwendet wurden (Quelle: Carlotti, CFEETK 2001
und www.maat-ka-re.de)
Evtl. frühere Bautätigkeit
Hatschepsuts im Mut-Bezirk
Der "heilige Bezirk der Mut" (Gemahlin des
Amun) befindet sich südlich des Großen Tempels des Amun und ist mit diesem
durch eine Prozessionsstraße, die von widderköpfigen Sphingen gesäumt wird,
verbunden. Auf der Südseite wird der Tempel der Mut auf drei Seiten von einem
hufeisenförmigen Heiligen See (=Isheru) umschlossen.
Die frühesten erhaltenen Bauten stammen
lt. der John Hopkins University aus der Zeit von Hatschepsut und Thutmosis
III. Aber in letzter Zeit entdeckten die Forscher Hinweise auf einen Tempel
aus dem Mittleren Reich. In der Regierungszeit von Amenophis III. wurde der
Tempel jedoch vollständig neu gestaltet, so dass die heute noch sichtbaren
Überreste des Tempels vor allem die Bautätigkeit dieses Königs, wie z. B.
den von Sachmet-Statuen gesäumten Vorhof, reflektieren. Nach Amenophis III.
haben vor allem Tutanchamun, Ramses II. und Ramses III., Nectanebos, Alexander
der Große sowie verschiedene römische Herrscher Tempelteile abreißen,
restaurieren, anbauen oder neu bauen lassen.
Zwar fehlten bislang die archäologischen
Nachweise für eine Bautätigkeit unter Hatschepsut/Thutmosis III. am Tempel
der Mut, doch findet sich an den Wänden der Roten Kapelle (Südwand, Block
179, Szene 5) ein Hinweise auf eine dementsprechende Bautätigkeit für die
Göttin Mut von Ischeru (wobei mehrere Blöcke an dieser Stelle fehlen wodurch
die Darstellung unterbrochen ist.
"Der
Tempel der Maat-ka-ra, geliebt von Mut, Herrin von Ischeru"
(Block 179, Szene 5) - Quelle:
www.maat-ka-ra-de |
Des weiteren kamen bei den Ausgrabungen der
John-Hopkins University unter Leitung von Betsy Brian während der letzten
Jahre mehrere Blöcke aus der Zeit von Hatschepsut/Thutmosis III. ans
Tageslicht. Diese waren beim Neubau unter Amenophis III. in den Fundamenten
verbaut worden - so z. B. zahlreiche Säulentrommeln von 16-seitigen Säulen
(wie sie unter Hatschepsut verwendet wurden). Einige dieser Säulen (auf denen
sich auch teilweise die Kartusche mit ihrem Thronnamen befindet) konnte man
wieder zusammenfügen, so dass man fast wieder eine vollständige Säule
erhielt, die von den Forschern der John Hopkins Universität im 1. Hof des
Tempels auf einem modernen Fundament zusammen mit weiteren Säulenresten zu
zwei Säulenreihen rekonstruiert wurden.
Auch die Forscher des Brooklyn-Museum begannen
1976 mit der ersten systematischen Erforschung des gesamten Geländes, um die
Beziehung der Monumente zueinander herauszufinden. Das Detroit Institute of
Arts beteiligte sich von 1978 bis 2010 daran und ab 2001 gab es mit der
Expedition der John Hopkins Universität unter Leitung von Dr. Betsy Bryan
eine Übereinkunft, das Gelände gemeinsam zu untersuchen. Zwar operierten die
Expeditionen unabhängig voneinander aber bei den Konservierungs- und
Erhaltungsprojekten wurde nun zusammengearbeitet.
Thutmosisches Tor
Lt. der Feldforschung des "arce.org/project/mut-Tempel/"
(Brooklyn Museum unter Leitung von Richard A. Fazzini) war das kleine
thutmosidische Tor westlich der Ischeru auf den Karten aus dem 19. Jahrhundert
bis 1976 verschwunden. Es wurde von der Brooklyn-Expedition wiederentdeckt und
zeigte die Kartuschen von Thutmosis III. und Thutmosis II. (wobei die Forscher
die Vermutung hegten, dass diese evtl. anstelle von ursprünglich den
Kartuschen von Hatschepsut dort standen). Das Tor und die dazugehörigen
Mauern bildeten bis zur 25. Dynastie die westliche und nördliche Grenze des
Bezirks.
Tempel des Kamutef
Der in der Regierungszeit der Hatschepsut erbaute
Kamutef-Tempel befindet sich nordöstlich vor dem ummauerten Tempelbezirk der
"Mut von Ascheru (Isheru)", an der 330 m langen Sphingenallee mit
beidseitig 66 Sphingen (errechnet von Traunecker und Dieter Arnold / die
Tempel Ägyptens, Götterwohnungen, Baudenkmäler, Kultstätten, Zürich
1992).
|
Blick auf die
Prozessionsallee zum 10. Pylon
- gesäumt wurde der 330 m lange Prozessionsweg beidseitig mit
insgesamt 66 Sphingen - |
|
Bild: Neithsabes Wikipedia - public domain |
Lt. Ricke wurde der Kamutef-Tempel -
aufgrund der gefundenen Relieffragmente - ursprünglich von Hatschepsut und
wurde dann während der Alleinherrschaft von Thutmosis III. übernommen, der
alle ihre Kartuschen wegmeißeln und in einigen Fällen durch seine eigenen
Kartuschen ersetzen ließ (usurpieren). Später wurde der Bau unter Sethos I.
restauriert und Ramses IV. ließ ebenfalls seine Namen im Tempel anbringen (siehe
dazu: Herbert Ricke, Das Kamutef-Heiligtum Hatschepsuts und Thutmosis III. in
Karnak, Bericht über eine Ausgrabung vor dem Muttempelbezirk, Schweizerisches
Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde, Kairo 1954). Weitere
Infos zum Kamutef-Tempel siehe unter Thutmosis III.  .
.
Karnak-Süd - Stationstempel 1
Gegenüber vom Tempel des
Amun-Kamutef (siehe oben) - westlich von der Sphingenallee - befinden sich
Baureste eines Gebäudes, das vermutlich zum 6. Stationstempel der
Opet-Prozession gehörte. Dieser Tempel, der kein einheitlicher Bau war (lt.
Ricke wurden auch hier unterschiedliche Bauperioden festgestellt), war formal
und auch thematisch mit dem Kamutef-Tempel aus der gemeinsamen Zeit von
Hatschepsut/Thutmosis III. verbunden.
Hatschepsut
verkündete auf der Südwand der "Roten Kapelle", dass sie 6
Stationstempel (oder Barkenschreine) auf der Prozessionsstrasse von Karnak zum
Luxortempel errichten ließ. Die Königin machte - nachdem die Barke des
Amun-Re beim Opet-Fest den "Auserwählten Orte" (den Ipet-Sut-Tempel
/ Karnaktempel) verlassen hatte - im Rahmen der heiligen Prozession an jeder
dieser Barkenschreine Halt und die Barke ruhte dann auf dem Barkenschrein -
wie die Darstellungen auf der Roten Kapelle uns berichten.
Bei
den Ausgrabungen im Luxortempel fand man Reste eines Stationstempels, die von
Ramses II. im Triple-Schrein verbaut wurden und wobei es sich vermutlich um Blöcke
aus dem 6. Barkenschrein handelte. Reste eines weiteren Barkenschreins
befinden sich an der Bodenoberfläche gegenüber dem Kamutef-Tempel. und gehörten
evtl. zum 1. Stationstempel/Barkenschrein der Opet-Prozession. Dieser 1.
Barkenschrein, in welchem Thutmosis III. auf der rechten Seite vor der Barke
des Amun-Re opfert und die dann im Stationstempel abgestellt wird, wird auf
den Darstellungen der Roten Kapelle erwähnt. Sein Name war "Amun von der
Treppe vor dem pr-hn"
(siehe hierzu  Bauten Thutmosis III. in Theben)
Bauten Thutmosis III. in Theben)
Von
den anderen 4 Barkenschreinen fand man keine Überreste - evtl. befinden sie
sich - zusammen mit den Resten der Sphingen-Allee unter der heutigen Stadt
Luxor.
|
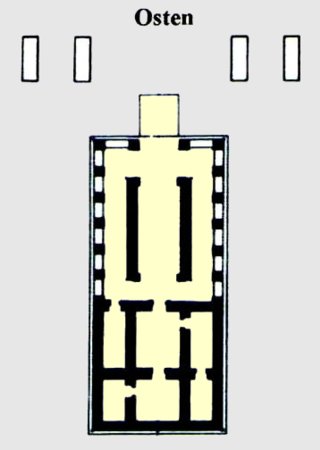
|
Stationsstempel
Hatschepsut/Thutmosis III
Barkenschrein 1
- Umzeichnung nach Ricke 1954
-
- modifiziert von
Nefershapiland -
- Bauphase 1
(nach Ricke) -
|
Dreifachschrein Ramses II. in Luxor /
Barkenstation der Hatschepsut
Die Inschriften auf der Roten
Kapelle in Karnak berichten, dass Hatschepsut insgesamt 6 Barkenschreine
(Stationsheiligtümer) zwischen dem Karnak-Tempel und dem Luxor-Tempel hat
errichten lassen, wobei es sich bei den Abbildungen der Stationsheiligtümer
auf der Roten Kapelle offensichtlich um schematisierte Darstellungen handelte,
die sich nicht an dem ursprünglichen Bauwerk orientierten. Neben der 1.
Barkenstation, die oben beschrieben wurde, ist nur noch die letzte der 6
Barkenstationen aus der Zeit Hatschepsuts bekannt.
|
Barkensanktuar Ramses II im 1. Hof des
Luxortempels
mit Bauteilen einer Stationskapelle von Hatschepsut |
| Der komplette Bauplan des Bauwerkes wurde bei der
Wiedererrichtung durch Ramses II. verändert. Zur Zeit von Hatschepsut
waren alle Stationsheiligtümer/Barkenstationen vermutlich
"Durchgangsbauten" (wie die Rote Kapelle) mit einem Eingang
für die Götterbarke auf der einen Seite und einem Ausgang auf der
anderen Seite.
Die unter Ramses II. errichteten Kapellen weisen jedoch jeweils
nur einen Zugang auf - sind also "Sachgassen". |
|
Bild: Courtesy to Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Barkensanktuar Ramses II im 1. Hof des
Luxortempels
- vom Festhof aus gesehen - |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- Lizenz: CC
BY-NC-SA 2.0 - |
Bei der Erweiterung des Luxor-Tempels
durch Ramses II. in der 19. Dynastie ergänzte dieser die Tempelanlage durch
seinen schräg angesetzten Säulenhof samt Pylon und einer neuen Verbindung
zum Nil - aufgrund der Opet-Fest Darstellung im Kolonnadenhof wissen wir, das
spätestens seit Tutanchamun die Opet-Prozession beide Wege vom Karnak-Tempel
zum Luxor-Tempel und zurück auf dem Nil zurücklegte, daher muss es bereits
zu dieser Zeit eine Verbindungsstrasse zum Nil gegeben haben (Quelle: www.maat-ka-ra.de).
Ramses II. verlegte nun durch seine Erweiterung den Haupteingang auf die
Nilseite, so dass dieser Weg nun genau auf das Ramesseum ausgerichtet
war.
Unmittelbar vor der Innenseite des
Westflügels seines neu errichteten Pylons befindet sich im Kolonnadenhof von
Ramses II. ein Stationsheiligtum mit drei Kapellenräumen (engl. "Triple-Shrine")
für die Triade von Theben, die Götter Amun, Mut und Chons, deren Barken hier
während der Prozession vom Karnak-Tempel zum Luxor-Tempel bei den
Opet-Feierlichkeiten Station machte. Bei der Errichtung seines
Dreifachschreines, der wohl in seiner ursprünglichen Planung so nicht
vorgesehen war - wie die Forscher anhand von mehreren architektonischen
Details an den letzten drei Säulen der inneren westlichen Säulenreihe
erkannt haben - wurde die
Bauplanung des Hofes noch vor der Fertigstellung der umlaufenden Säulenreihen
des Hofes geändert.
Die Architekten von Ramses II.
verwendeten dazu einige Blöcke und die 4 Säulen aus Rosengranit aus einer
Barkenstation der Hatschepsut, die wohl nicht weit entfernt vom heutigen
Standort der Dreifachkapelle stand. Auf den Säulen und den
Architekturelementen aus der Zeit Hatschepsuts befanden sich nach L. D. Bell
(1986) Textkolumnen mit ihrem Namen (usurpiert teilweise von Thutmosis III).
Bei einer späteren, genaueren Inspektion des Dreifach-Schreines wurden neben
den bereits erwähnten Architekturteilen (Säulen und Blöcke eines
Architravs) 19 neue Fragmente der Hatschepsut zutage gefördert. Diese waren
in den Mauerteilen der Kapellen des Amun und der Mut verbaut worden. Aus der
Verwendung der weiblichen Form bei der Bezeichnung des Herrschers ergaben sich
weitere Hinweise auf die Königin (Quelle: Christian Leblanc/Mansour Boraik:
Le Bulletin Momnonia / Fondateur et directeur de la publication).
|

|
Säulen aus der Zeit
Hatschepsut
Die
vor den Barkenschreinen stehenden vier Rosengranitsäulen wurden während
der Regierungszeit Ramses II. überarbeitet und tragen außer Namen
und Titulatur Ramses II. extrem wenig Text (zuzüglich dem
Beinamen "geliebt von Amun").
Zwei
der überarbeiteten Paneele zeigen allerdings in ihrer
grammatikalischen Schreibung die feminine Form des Wortes
"geliebt" [also anstatt "mrj"="mrj.t").
Sie beziehen sich damit auf einen weiblichen König, der vor Ramses
II. regiert hatte.
Bild:
Courtesy to Saamunra
- alle Rechte vorbehalten -
|
|

|
Steinblock in der Amun-Kapelle
Dieser Steinblock, der unter dem Boden der (rechten)
Mut-Kapelle wiedergefunden wurde, ist heute auf dem Boden der zentralen
Amun-Kapelle platziert und war wohl ursprünglich ein Teil der VI.
Barkenstation von Königin Hatschepsut entlang des Prozessionsweges zum
Luxor-Tempel. Die Darstellungen zeigen vorne eine Reihe von Männern,
die alle auf einem Korb (nach Lanny Bell 1998) knien und ihre Hände in
Anbetung vor Amun erhoben haben. Vor ihnen befinden sich die Namen und
Beinamen von Amun - in der Amarnazeit ausgelöscht und später wieder
restauriert.
Bild: Courtesy to Gitta Warnemünde
- alle Rechte vorbehalten - |
Im Garten vor dem Luxormuseum steht eine Statue im
osiden Gewand, die mit den Kartuschen von Ramses II. beschriftet ist,
wahrscheinlich aber die Königin Hatschepsut darstellt, da sie optisch in
ihrer Ausführung sehr den osiden Statuen im Totentempel der Hatschepsut in
Deir el Bahari ähnelt.
Der 8. Pylon von Karnak
Der 8. Pylon von Karnak befindet sich auf dem
Prozessionsweg nach Süden zum Luxor-Tempel hin und wurde unter Hatschepsut
errichtet - oder evtl. schon von ihrem Vater Thutmosis I. / oder ihrem
Brudergemahl Thutmosis II. - evtl. ersetzte er einen älteren Vorgängerbau
aus Nilschlammziegeln (möglicherweise Amenophis I.). Im unteren Bereich war
er von einer niedrigen Kalksteinmauer umgeben.
|
Südansicht des 8. Pylon - errichtet unter
Hatschepsut |
| Der 8. Pylon ist der erste Bau im antiken Ägypten,
der komplett aus Sandstein errichtet wurde. Die Dekoration ihres
Pylons ist wahrscheinlich am Ende ihrer Regierungszeit zu datieren,
worauf die Schreibweise des Thronnamens von Thutmosis III. "Men-cheper-ka-Re"
hinweist, welche dieser nur in den Jahren ihrer gemeinsamen
Co-Regentschaft (Jahr 5-20) verwendete. Die Länge des Pylons
betrug 47,43 m. Überall da, wo der Name oder die Darstellung von
Königin Hatschepsut am Pylon sichtbar waren, wurden diese zu einem
späteren Zeitpunkt - wohl während der Alleinherrschaft von Thutmosis
III. - abgeändert.
An der Südfront des Pylons ließ Thutmosis III. ebenfalls
Änderungen an dort befindlichen kolossalen Sitzstatuen vornehmen.
Drei der Statuen weisen noch heute Bauinschriften von Thutmosis III.
auf, die sich auf die Vollendung der Rundbildnisse beziehen. Alle
dieser Inschriften wurden an der Vorderseite der Thronsitze
eingraviert, so dass sie für jeden von Süden kommenden Besucher
sichtbar waren.
Es ist erstaunlich, dass dieser VIII. Pylon nirgendwo in den
überlieferten Inschriften von Hatschepsut oder Thutmosis III.
erwähnt wird (lt. Grimal und Larché in Cahiers de Karnak, XII,
2007). |
Bild: Achter
Pylon, Tempel Karnak
Autor: Olaf Tausch, Wikipedia 4.3.2011
Lizenz: CC
BY-3.0 |
Die ursprüngliche Dekoration der Königin ist heute
größtenteils verloren gegangen, da sie später von Thutmosis III., Amenophis
II., Tutanchamun und Sethos I. mehrfach überarbeitet wurde. An der Außenfassade
ist Amenophis II. beim "Erschlagen der Feinde" vor Amun zu sehen.
Die Inschriften aus der Zeit von Hatschepsut sind größtenteils zerstört. An
der Innenfassade (Ostseite) dankt Thutmosis I. Amun für die Inthronisierung
seiner Tochter Hatschepsut (Inschriften sind ausgehackt - die Kartuschen von
Hatschepsut wurden durch den von Thutmosis II. ersetzt).
Überarbeitungen
Sethos I. ließ auf der Nordseite des 8. Pylon die Schäden aus der Amarnazeit
an den Darstellungen von Thutmosis II. (vormals evtl. Hatschepsut), deren
Restaurierung bereits unter König Haremhab begonnen haben, ebenfalls nochmals
restaurieren. Sowohl die westlichen als auch die östlichen
Barkendarstellungen (PM 517-519) zeigen Bearbeitungen von Haremhab und Sethos
I. Nach Murname wurden schon unter Tutanchamun erste Restaurierungsarbeiten
vorgenommen (siehe W. J. Murname / Tutankhamon on the Eight Pylon at Karnak
1985). Sethos I. ließ auch die Rede des Gottes, die unter Tutanchamun
überarbeitet wurde löschen und durch neue Worte, die seine eigenen
Restaurationsarbeiten hervorheben, ersetzten. Am westlichen Turm auf der
Südseite sind Überarbeitungsspuren bei den Federn des Gottes Amun erkennbar,
des weiteren an der Basis des Oberschenkels, am vorderen Bein und an der
Vorderseite des Götterbartes zwischen Kinn und Schulter (siehe: The monuments
of Seti I. and their Historical signifiance by Peter James Brand /
pdf-online-Version).
Nordseite
des VIII. Pylons
Vor
dem Westflügel der Nordseite des VIII. Pylons - rechts neben den Fragmenten
der Statue aus Grauwacke - befinden sich
die
Überreste einer Mauer (?) oder Einfassung aus Kalkstein, die bis zu einer Höhe
des 1. Registers auf der dahinterliegenden Pylonwand reicht. Es kann heute
nicht mehr belegt werden, inwieweit diese Mauer den Pylon umfasste - eine
vollständige Umschließung, wie es Baguet (Le Temple d'Amon-Re á Karnak,
1962, S. 258ff) für möglich hält, ist nicht nachweisbar. Die Funktion
dieser Mauer ist unbekannt und die Inschrift auf der Einfassung so stark zerstört,
dass sie heute nicht mehr lesbar ist - ebenso die Inschriften der Königin
Hatschepsut auf der Nordseite des VIII. Pylons, die weitgehend verändert,
ausgelöscht oder überschrieben wurden.
|
Westflügel der Nordseite -
Überreste einer Einfassung aus Kalkstein (?) |
| Vor
dem westlichen Flügel des VIII. Pylons befinden sich Reste eine
niedrigen Einfassungs-Mauer (siehe Pfeil), auf der man noch Spuren
einer Inschrift erkennen kann. Die Mauer steht auf einem Sockel aus
Ziegeln und reicht bis zu einer Höhe des 1. Registers an der Pylon-Außenwand.
Es ist aber unklar, ob die Mauer den ganzen Pylon umschloss, wie
Barguet (Le temple d'Amon-Re á Karnak, 1962, S. 258ff) vermutete
- auch über Sinn und Zweck dieser Mauer gibt es keine Informationen.
Das CFEETK ließ dazu verlauten, dass sich eine vollständige
Umschließung des VIII. Pylons durch die Einfassungsmauer nicht
belegen lässt (Quelle: www.maat-ka-ra-de).
Vor
dem Ostflügel der Nordseite sind im übrigen keine derartige Baureste
zu erkennen.
Die Mauer auf der Ostseite ist nach oben hin wie eine Brüstung
abgerundet und in ihrer Art und Weise bislang einzigartig. Die
Inschrift ist zu zerstört, als dass man sie lesen könnte. |
|
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
|
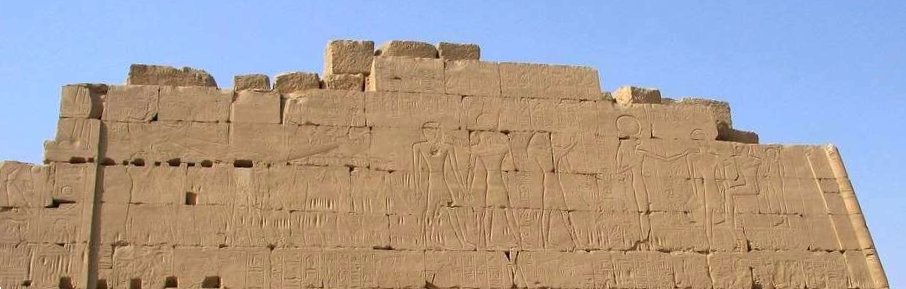
|
|
VII. Pylon Nordseite - Westflügel (getilgt,
verändert oder überschrieben durch Thutmosis III.) |
| Im
1. oberen Register befindet sich links die Barke des Amun, die von den
Priestern auf ihren Schultern getragen wird und der König Thutmosis
II. (ursprünglich wohl Hatschepsut), der von Month an der Hand
geführt wird. In der nächsten Szene steht der König (lt. Kartusche
Thutmosis II. - ursprünglich aber wohl die Königin Hatschepsut), der
vor dem thronenden Gott Amun-Re steht (hier sind ebenfalls deutlich
Abänderungen bei der Figur des thronenden Amun-Re und auch bei dem
hinter ihm stehenden Gott Chons erkennbar). Hinter dem König steht
noch die Göttin Weret-Hekau, die mit einem "sehr langen (?) Arm
ihre Hand auf seine Schultern legt. Zwischen Göttin und König
befinden sich Restaurationstexte von Sethos I. Der hinter der Göttin
stehende Gott Thot notiert "die Regierungsjahre" des
Königs.
In allen Szenen nennen die Kartuschen den König Thutmosis II.
als die dargestellte Figur - in allen Fällen dürfte es sich - ebenso
wie auf dem Ostflügel - jedoch um eine nachträgliche Änderung der
Kartuschen von Hatschepsut handeln, die im Zuge ihrer
"Verfolgung" getilgt und umgeändert wurden.
Die Darstellungen im 2. (unteren) Register (4 Szenen) und im 3.
Register (8 Szenen) tragen die Kartuschen von Ramses III. und wurden
auch original in dieser Zeit dekoriert. |
|
Bild: Hanne Siegmeier (Ausschnitt erstellt von
Nefershapiland) |
Ostflügel der Nordseite
Auch
vor dem östlichen Pyloneingang scheint einst eine königliche Statue
gestanden zu haben. Lt. dem Plan von Porter & Moss, einem alten Foto bei
Schwaller de Lubicz (Karnak, Platte 380-381) und dem Werk von Grallert
(Bauen-Stiften-Weihen) befinden sich vor beiden Torpfosten an der nördlichen
Pylonseite Überreste von Statuen, die auf einer Basis aus Sandstein ruhten
(siehe weiter oben), wobei vor dem östlichen Pylon nur noch Spuren der Basis
zu erkennen sind (auch nur auf dem Foto bei Schwaller de Lubicz).
|
Nordseite des 8. Pylon - Ostflügel - |
| Auf dem Ostflügel - direkt
neben dem Durchgang - ist im oberen Register die Göttin Weret-Hekau
zu sehen, die König Thutmosis II. nach links zu der dort wartenden
Göttin Hathor führt, die einen "nini"-Gestus ausführt.
Hinter dem König folgt die Barke des Amun-Re, die von den Priestern
auf ihren Schultern getragen wird. |
|
Bild: Courtesy to Hanne
Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Nordseite des 8. Pylon - Ostflügel - unteres
Register |
| Im unteren Register des
östlichen Flügels steht Thutmosis I (Vater von Hatschepsut) vor der
thebanischen Triade (Mitte) Amun, Mut und Chons. Er bedankt sich
in einer Rede bei dem thronenden Amun-Re dafür, dass dieser seine
Tochter Hatschepsut (später geändert auf Thutmosis II.) auf den
Thron gesetzt hat (siehe Urk. IV. Paragr. 271 ff. u. PM ² II, S. 174
[517] ). |
|
Bild: Courtesy to Hanne
Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
Karnak - Tempel des Ptah
Das französische CFEET ließ 2009 am Tempel des
Ptah in Karnak Restaurationsarbeiten durchführen und fand im Fundament
verbaut zwei Sandsteinblöcke, auf denen fast die vollständige Titulatur der
Hatschepsut im versenkten Relief stand (Thron- und Geburtsnamen auf dem einen
und der Horus-Name auf dem anderen Block). Die Forscher gehen davon aus, dass
diese beiden Blocke vermutlich zu einem von Hatschepsut erbauten Tempel des
Ptah gehörten. Man fand auch weitere, im Fundament verwendete Blöcke aus
Sandstein in vergleichbarer Größe. Diese könnten ebenfalls zu dem
erwähnten Tempel gehören - evtl. wurden bei diesen die dekorierten Seiten
nicht sichtbar arrangiert (2).
Der Tempel von "Kha-Achet"
in Theben-West
Bei den Ausgrabungen 1970-71 der
polnisch-ägyptischen Mission und dem Versuch eine Wasserpumpe beim
Totentempel der Hatschepsut zu installieren, stieß man auf die Basis einer
Sandstein-Säule. Bei den weiteren Grabungen 1970/71, 1971/72 und 1977/78
kamen dann zahlreiche Reste eines Tempels ans Licht. Statuenfragmente,
Sandstein-Säulenbasen und Mauern und andere Architekturteile (siehe Barakat,
1981). Die Anlage war aber aufgrund der Nilüberflutungen in antiker Zeit
äußerst schlecht erhalten - aber trotzdem gelang es den Forschern aufgrund
der gefundenen Statuenfragmente und Inschriften das Bauwerk in die Zeit von
Hatschepsut und Thutmosis III. zu datieren. Einige der gefundenen Inschriften
trugen die Kartuschen von Thutmosis I., Thutmosis II. und III, wobei an den
mit dem Namen von Thutmosis I. und II. deutliche Spuren von Änderungen zu
erkennen waren, also höchstwahrscheinlich sekundär erstellt worden sind. Auf
zwei von den erhaltenen Inschriften mit den Kartuschen von Thutmosis II. fand
man Reste einer femininen Endung mit der Hieroglyphe "t" - beide
zugehörig zu einem "Sa(t)-Ra" (Tochter des Ra), was vermuten
lässt, dass hier ursprünglich nicht "Sohn des Ra", sondern
"Tochter des Ra" stand.
In der Ausgrabungs-Saison 1977-78 fand
man die Basis einer Sandstein-Säule in situ - zusammen mit
Kalksteinfragmenten. Auch hier fanden sich in den Inschriften die usurpierten
Kartuschen von Thutmosis I. - II. und III. und sogar eine Kartuschen von
Hatschepsut, was einige der Forscher vermuten ließ, dass es sich bei dieser
Ausgrabungsstätte um den bislang nicht lokalisierten Tempel "Kha-Achet"
(Hügel am Horizont) handeln könnte. Dieser Tempel wurde in den Reliefs der
Roten Kapelle erwähnt und auf Grundstein-Depots, die man in der Umgebung von
Deir el-Bahari gefunden hatte und auf der Northampton-Stele in der Grabanlage
des Djehuti (Quelle: www.maat-ka-ra.de)
.
Allerdings ist diese Zuweisung nicht unbestritten
und wird unter den Ägyptologen teils kontrovers diskutiert. Brovarski ( 1976)
möchte das "Kha-Achet" mit dem zentralen Sanktuar von
Djeser-Djeseru identifizieren, was aber auch von anderen Forschern
angezweifelt wird. So muss es also unklar bleiben, um welches Bauwerk es sich
bei den Funden des polnisch-ägyptischen Grabungsteams handelt (2).
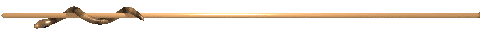
weiße Links sind noch Baustelle......
Quellen und Literatur:
1. Wikipedia: Rote Kapelle
2. www.maat-ka-ra.de von Dr. Karl
Leser
3. Silke Grallert: Bauen-Stiften-Weihen, 2001, Achet-Verlag Berlin
4. Marianne Schnittger: Hatschepsut - Eine Frau als König von Ägypten,
Ph. v. Zabern-Verlag, Mainz am Rhein, 2008 - ISBN: 978-3-8053-3810-3
|
home |
Sitemap |
Beamte Hatschepsut |
Totentempel Hatschepsut |
![]()
![]() (Bauten Thutmosis III./Hatschepsut). Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute
unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges.
Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und
schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich
wurde sie kurz nach dem Tod von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die
Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil
die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder
Thutmosis II. ersetzt wurde.
(Bauten Thutmosis III./Hatschepsut). Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute
unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges.
Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und
schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich
wurde sie kurz nach dem Tod von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die
Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil
die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder
Thutmosis II. ersetzt wurde.![]()